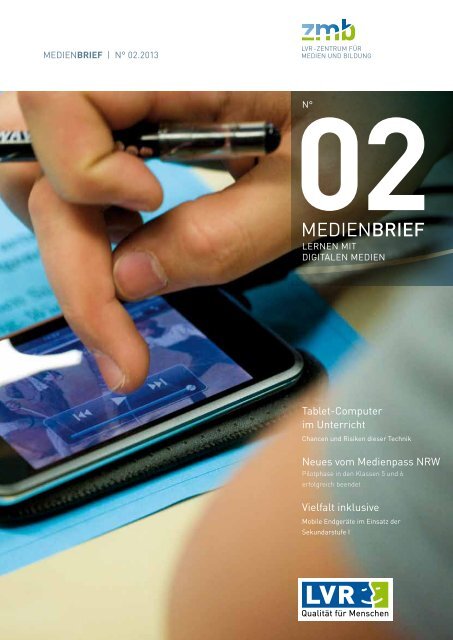Link zum Download der aktuellen Ausgabe Medienbrief (PDF, 2607 ...
Link zum Download der aktuellen Ausgabe Medienbrief (PDF, 2607 ...
Link zum Download der aktuellen Ausgabe Medienbrief (PDF, 2607 ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
MEDIENBRIEF | N° 02.2013ImpressumHerausgeberLandschaftsverband RheinlandLandeshauptstadt DüsseldorfLVR-Zentrum für Medien und BildungMedienzentrum für dieLandeshauptstadt DüsseldorfMedienberatung NRWSchulmanagement NRWRedaktion, Layout & ReinzeichnungManfred Kremers, DüsseldorfPostanschriftPostfach 10345340025 DüsseldorfBesucheranschriftBertha-von-Suttner-Platz 140227 DüsseldorfKontaktTelefon (0)211 27 404-0Fax (0)211 27 404-32 00E-Mail Michael.Jakobs@lvr.deInternet www.medien-und-bildung.lvr.deTitelfotoDominik Schmitz, LVR-ZMBDruckHei<strong>der</strong> Druck GmbHPaffrather Straße 102 –11651465 Bergisch GladbachAuflage6000Der MEDIENBRIEF erscheintzweimal jährlich und ist kostenlosISSN 1615-72572
Der MEDIENBRIEFim Wandel <strong>der</strong> ZeitMichael ThesselLeiter des LVR-Zentrumsfür Medien und BildungFoto: Benedikt Klemm, LVR-ZMBLiebe Leserin, lieber Leser,diese neueste <strong>Ausgabe</strong> des <strong>Medienbrief</strong>smöchte ich <strong>zum</strong> Anlass nehmen,seine Anfänge vor fast 20 Jahrenund die Entwicklung, die er in dieserZeit genommen hat, kurz in Erinnerungzu rufen. Aus ersten Hausmitteilungsblätternfür die DüsseldorferLehrerschaft entwickelten sich einbescheidenes, wenig Seiten umfassendesHeft, das in den Schulenjedoch eine unerwartete Akzeptanzfand – daraus geworden ist im Laufe<strong>der</strong> Jahre ein vollwertiges Fachmagazin,das von Lehrkräften aller Schulformenim ganzen Rheinland – unddarüber hinaus – aufmerksam gelesenwird.Der gewachsene Umfang, die größereZielgruppe, die erweiterte Themenvielfaltund das immer professionellereLayout des <strong>Medienbrief</strong>s spiegelngewissermaßen auch den Wandel desLVR-Zentrums für Medien und Bildungwie<strong>der</strong>.Die Entwicklung von <strong>der</strong> ursprünglichenLandes- und Stadtbildstelle überdas Medienzentrum Rheinland hin<strong>zum</strong> LVR-Zentrum für Medien undBildung ging einher unter an<strong>der</strong>emmit einer inhaltlicher Neuausrichtung– die Integrierung <strong>der</strong> MedienberatungNRW und des Schulmanagement NRWals pointiert schulische Schwerpunktemit landesweiter Reichweite – o<strong>der</strong><strong>der</strong> Professionalisierung <strong>der</strong> Medienproduktionals Full-Service-Anbieterim Bereich Digitalisierung, Film- undAudio-Produktion sowie Webkonzeptionund –umsetzung.Nicht zuletzt die Namensän<strong>der</strong>ung hatuns davon überzeugt, ein run<strong>der</strong>neuertes,mo<strong>der</strong>nes Corporate Design fürdas LVR-Zentrum für Medien undBildung zu implementieren – <strong>der</strong>vorliegende <strong>Medienbrief</strong> ist das ersteProdukt im neuen Erscheinungsbild.Die im Haus über Jahrzehnte gesammeltenErfahrungen in <strong>der</strong> Fotoproduktion,werden im »neuen« <strong>Medienbrief</strong>durch eine eindrucksvolleBildsprache <strong>zum</strong> Ausdruck gebracht.Ich hoffe, Sie finden nicht nur amInhalt, son<strong>der</strong>n auch am neuenErscheinungsbild Gefallen.Viele Anregungen und Interesse fürdie angesprochenen Themen wünschtIhnenIhrDüsseldorf, im August 20133
MEDIENBRIEF | N° 02.2013Inhalt –unsereThemenMEDIENBRIEFN° 02.2013Vorwort 02Inhaltsverzeichnis 04Kurzinformationen 0601 Lernen mit digitalen Medien> Digitale Medien im Unterricht –Schulbücher in digitaler Form – Lernen undSchultaschen werden leichter 08> learn:line – Ein unverzichtbarer Unterrichtsbaustein 12> Neues vom Medienpass NRWPilotphase in den Klassen 5 und 6 erfolgreich beendet 13> Tablet-Computer in den MINT-Fächern –Über Chancen und Risiken dieser Technik 14> Rendezvous im Apple-Store 17> Wasser – ein Klassiker im neuen (iBook-)Gewand 18> Virtuelle Schreibkonferenzen mit Wiki-Technologiein <strong>der</strong> Grundschule 21> »Vielfalt inklusive« –Mobile Endgeräte im Einsatz in <strong>der</strong> Sekundarstufe I 24> »Handys raus!« –Zum Umgang mit mobilen Netzwerken in Schulen 26> eSchool: Auf neuen Wegen 28> EDMOND NRW mit iPad offline nutzen 30> EdOn – ein Beitrag <strong>zum</strong> Medienkonzept <strong>der</strong> Zentren fürschulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL) 31> Blumio macht Schule …YouTube verleiht jungem Rapper Kultstatus. 3202 Berichte> Fantasieren – Experimentieren – Fotografieren 35> »Das ist ja <strong>der</strong> Hammer!« –Die Foto-Mitmachaktion des LVR-ZMB am Tag <strong>der</strong> Begegnung 36HinweisWir sind bemüht, in unseren Beiträgen Aspektedes »Gen<strong>der</strong> Mainstream« zu beachten und nachMöglichkeit auf Personen bezogen sowohl dieweibliche als auch die männliche Form zu nutzen.Aus Gründen <strong>der</strong> Vereinfachung und besserenLesbarkeit wird dies nicht von allen Autorinnenund Autoren so gehandhabt. Das möchten wirrespektieren, legen jedoch Wert auf den Hinweis,dass in <strong>der</strong> Regel das jeweils nicht erwähnteGeschlecht mit einbezogen ist. Die Redaktion03 Partner im Verbund> Länger gemeinsam lernen – Schulentwicklung in NRW 38> »Auf dem Weg zur inklusiven Schule« 39> Inklusive SchulKinoWochen NRW 2013Eine filmische Projektdokumentation 40> »fit4web«Moodle-Kurs <strong>der</strong> Bezirksregierung Düsseldorf 41> Grimme-Online-Award 43> Westfalen geben immer Vollgas! –Werbeinitiative mit selbstironischen Postkarten 454
Inhalt – unsere ThemenFoto: Dominik Schmitz, LVR-ZMB04 Veranstaltungen> Kin<strong>der</strong>KinoFest Düsseldorf 48> »Vielfalt. Nutzen.« – 5. Bildungspartner-Kongress 5005 Besprechungen> Lehrer und Lehrerinnen als »Akteure des Wandels« 52> Wer war Kafka? – Filmporträt liefert erhellendeEinblicke in die geheimnisvolle Welt des Franz Kafka 55> Create, Play, Explore – Mit <strong>der</strong> Kaiserdom-App Neues entdecken 5706 LVR-ZMB intern> Audiovisuelle Medien zu gesellschaftsrelevanten Themen 59> Auszug von Spielfilmen mitLandeslizenzen bei EDMOND NRW 61> An ihr kommt je<strong>der</strong> vorbei –Nordlicht als rheinische Frohnatur am Empfang des LVR-ZMB 6207 Lernort Kultur> »Welt in Farbe« – Farbfotografie vor dem Krieg 64> Man Ray - Fotograf im Paris <strong>der</strong> SurrealistenAusstellung im Max Ernst Museum Brühl des LVRvom 15.09. bis 08.12.2013 66> Bernd und Hilla Becher: HochofenwerkeEine Ausstellung vom 20. September 2013 bis 26. Januar 2014 675
MEDIENBRIEF | N° 01.201301Lernenmitdigitalen MedienWelche Bedeutung haben Lernmittel bei zunehmen<strong>der</strong>Heterogenität von Lerngruppen auf dem Weg zur inklusivenSchule? Warum ist Vielfalt von Lernmitteln wichtig undin welche Richtung müsste sich die Qualität entwickeln?Foto: Dominik Schmitz, LVR-ZMB8
MEDIENBRIEF | N° 02.2013nem halben Schuljahr bis zu sechsJahren, <strong>zum</strong> Beispiel <strong>der</strong> komplettenSekundarstufe. Das Schulbuch wirdvon Redaktionen zusammengestelltund folgt einer Systematik im LernundKompetenzaufbau – es enthälteinen erkennbaren »roten Faden«. Jenach Fach und je nach Eignung fürdie konkrete Schülergruppe wird esunterschiedlich intensiv im Unterrichteingesetzt.Der »rote Faden« ist sehr wichtigfür den Fachunterricht einer Schule,beson<strong>der</strong>s wenn vielfältige z. B.über learn:line NRW verfügbare o<strong>der</strong>auch selbst erstellte Lernmaterialieneingesetzt werden. Ein roter Fadensichert die gemeinsame Orientierung,Zielgerichtetheit und Kontinuitätdes Fachunterrichtes an <strong>der</strong> jeweiligenSchule. Für Schülerinnen undSchüler sowie <strong>der</strong>en Eltern entstehtTransparenz und Verlässlichkeit undvergleichbare Qualität von Unterrichtverschiedener Lehrerinnen undLehrer – ein wichtiges Kriterium zurBeurteilung in <strong>der</strong> Qualitätsanalysevon Schulen.Wie kann <strong>der</strong> rote Faden auch beimEinsatz unterschiedlicher Lernmittelgesichert und sichtbar gemachtwerden?Fachgruppen bzw. Fachkonferenzensetzen kompetenzorientierte Lehrplänein ein schulinternes Curriculumum und entscheiden sich für geeigneteLernmittel – häufig o<strong>der</strong> meistfür die Einführung eines Schulbucheso<strong>der</strong> einer aufeinan<strong>der</strong> aufbauendenSchulbuchreihe. Auf Vorschlag<strong>der</strong> Fachgruppe entscheidet letztlichdie Schulkonferenz über die Einführung<strong>der</strong> Schulbücher – Eltern sindsehr interessiert an <strong>der</strong> Frage, mitwelchen Lernmitteln mit welchem Zielgelernt werden soll.Mit <strong>der</strong> Vielfalt und Vielzahl verfügbarerdigitaler Lernmitteln erweiternsich die möglichen Lernmittel-Szenarien <strong>der</strong> Fachgruppen einerSchule. Die Beschränkung alleineauf das klassische Schulbuch ist oftnicht ausreichend. Die eher modularaufgebauten digitalen Lernmittel erscheineninsbeson<strong>der</strong>e für heterogeneLerngruppen in inklusiven Kontextenunverzichtbar.Szenario 1: Das klassische Schulbuchliefert den roten Faden und wird ergänztund angereichert durch modulartigedigitale Lernmittel für individuellesLernen, für Diagnostik undFör<strong>der</strong>ung durch die Lehrkraft. Dazugibt es Absprachen in <strong>der</strong> Fachgruppe,die zu Verlässlichkeit und Transparenzdes Unterrichtes führen.Szenario 2: Die Fachgruppe verzichtet– für definierte Themen undZeiträume – auf die Einführung einesSchulbuches und gestaltet ein eigenesLernmittelkonzept, das entlang desschulinternen Curriculums Angabenzu Materialien für aktives undselbstständiges Lernen, Diagnostikund individuelle För<strong>der</strong>ung enthält.Mit erkennbarem roten Faden für dasLernen im jeweiligen Fach kann es<strong>der</strong> Schulkonferenz zur Entscheidungvorgelegt werden.Neue Qualität digitaler Lernmitteldurch digitale Schulbücher?Seit November letzten Jahres bietenSchulbuch-Verlage einen Teil ihrerklassischen »analogen« Schulbücherauch in digitaler Form an (siehe Kasten).Damit werden den Schulen <strong>zum</strong>ersten Mal »konzeptionell gebundene«digitale Lernmittel angeboten, dievom Anspruch her ein kompaktes undvollständiges Lernangebot im Fachunterrichtdarstellen. Mit <strong>der</strong> digitalenVariante <strong>der</strong> klassischen Schulbücherbleibt <strong>der</strong> rote Faden erkennbar. Dasgewohnte Schulbuch wird durch ergänzendeLernmittel angereichert.Können digitale Schulbücher dieRücken <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> entlasten?Soweit das digitale Schulbuch mit <strong>der</strong>klassischen Buchvariante identisch ist,ist ein Szenario vorstellbar, Exemplarevon Schulbüchern in <strong>der</strong> Schulevorzuhalten, die im Unterricht genutztwerden, während z. B. Vorbereitungenund Hausaufgaben mit <strong>der</strong> digitalenVariante via Internet gemacht werden.Diese Schulbücher bräuchten dannnicht mehr auf dem Schulweg transportiertzu werden. Das ist zwar eineÜberlegung jenseits von Unterrichtsentwicklung,dafür aber gesundheitlichsehr überzeugend – gerade beijüngeren Schülerinnen und Schülern.Können denn Schülerinnen und Schülerzu Hause digital lernen?Alle Untersuchungen und Befragungenbelegen, dass bei <strong>der</strong> häuslichenIT-Ausstattung mit Internetanbindungvon nahezu 100% auszugehen ist. Mit<strong>der</strong> einfachen Aufteilung zwischenanalogen Lernmitteln in <strong>der</strong> Unterrichtsstundeund <strong>der</strong> Verfügbarkeit<strong>der</strong> digitalen Variante im geschütztenInternetbereich zu Hause lässt sicheine Verbesserung von Gesundheitund Lebensqualität <strong>der</strong> Schülerinnenund Schüler erreichen.Wenn Schulen diese Chance nutzenmöchten, wäre mit den Eltern vorabzu klären, ob tatsächlich bei allen10
Foto: Nicole Schäfer, LVR-ZMBSchülerinnen und Schülern die Zugängezu Computern und Internet zuHause sichergestellt sind. Um sozialeBenachteiligungen zu vermeiden,können im Dialog mit Schülerinnenund Schülern und <strong>der</strong>en Eltern Absprachengetroffen und <strong>zum</strong> BeispielZugänge zu digitalen Medien in <strong>der</strong>Schule angeboten werden.Soll Unterricht digitalisiert werden?Im Unterricht müssen und sollen unsereKin<strong>der</strong> sich gar nicht über längerePhasen mit einem Gerät beschäftigen– es gibt vielfältige Methoden undSozialformen des Lernens, die vielspannen<strong>der</strong> und effektiver sind.Unterrichtszeit ist Präsenzzeit für dieInteraktion von Menschen untereinan<strong>der</strong>.Kommunikations- und Arbeitswerkzeuge,die die digitale Welt bereitstellt, sind vor allem zur Vor-, Be- undNachbereitung im Lernprozess wichtig,wenn sich die Lernenden nichtzusammen in einem Unterrichtsraum,son<strong>der</strong>n in <strong>der</strong> Regel am heimischenSchreibtisch o<strong>der</strong> an an<strong>der</strong>en Lernortenin <strong>der</strong> Schule befinden.Auch wenn Unterricht als Präsenzzeitkeine ständige Arbeit mit Computerund Internet erfor<strong>der</strong>t, so muss esjedoch möglich sein, digitale Lernmittelimmer dann einzubeziehen, wenndas pädagogisch und fachlich sinnvollerscheint. Dazu sind Internetzugang,geeignete Eingabegeräte und eineProjektionsmöglichkeit erfor<strong>der</strong>lich.Die genaue Ausgestaltung <strong>der</strong> schulischenLern-IT ist von verschiedenenFaktoren abhängig wie etwa vonfachlichen Erfor<strong>der</strong>nissen o<strong>der</strong> <strong>der</strong>praktizierten Lehr- und Lernkultur(www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/lern-it/).Unterricht – mit o<strong>der</strong> ohne Computereinsatz– kann eingebettet undgesichert werden in einer digitalenLern-IT, die in <strong>der</strong> Schule und von zuHause aus zugänglich ist. Dort stehendie eingesetzten Lernmittel, die Aufgabenstellungwie die Arbeitsblätter,Hausaufgaben, Referate, Hinweise,Differenzierungen und Hilfestellungenje<strong>der</strong>zeit zur Verfügung.Wolfgang VaupelWolfgang Vaupel ist Geschäftsführer<strong>der</strong> Medienberatung NRW.Der Artikel ist so erschienen inSchule NRW (03-2013). Der Abdruck erfolgt mitfreundlicher Genehmigung.11
01 | LERNEN MIT DIGITALEN MEDIENNeues vom Medienpass NRWPilotphase in den Klassen 5 und 6 erfolgreich beendetDas Interesse war groß: Fast 400Teilnehmerinnen und Teilnehmerwaren <strong>der</strong> Einladung <strong>zum</strong> Kongress»Der Medienpass NRW auf dem Wegin die Sek. I« gefolgt, mit dem diePilotphase für die Klassen 5 und 6offiziell beendet wurde. iNRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann – Foto: Julia Reschucha, LVR-ZMBIn Ihrem Grußwort betonte Schulministerin Sylvia Löhrmannden Erfolg <strong>der</strong> Initiative. Der Medienpass NRW seiauch in den Klassen 5 und 6 angekommen, stellte sie fest.Der überwiegende Teil <strong>der</strong> Lehrerinnen und Lehrer aus denPilotschulen habe das Gesamtangebot mit Kompetenzrahmen,Lehrplanbezügen, Materialempfehlungen und demPass als Dokumentationsinstrument als geeignetes Mittel,um die Medienkompetenz <strong>der</strong> Schülerinnen und Schülersystematisch zu för<strong>der</strong>n, bestätigt.Obwohl sich die Ausgangslage in den weiterführendenSchulen von <strong>der</strong> Situation an Grundschulen unterscheideund Konzeptentwicklung und Absprache zwischen denKolleginnen und Kollegen einen größeren Stellenwerteinnähmen, könne <strong>der</strong> Medienpass NRW auch hier einpraxisnaher Begleiter für die Schülerinnen und Schülersein. Um ihn noch alltagstauglicher zu machen, werden dieAnregungen aus den Pilotschulen in das Konzept eingearbeitet.Auch die Anregungen <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler,die sich einen bunten Pass mit gut verständlichen Textenwünschten, werden umgesetzt.Die aktualisierten Klassenpakete mit Medienpässen für dieKlassen 5 und 6 stehen weiterführenden Schulen ab demSchuljahr 2013/14 zur Verfügung und können ab sofort überdie Webseite www.medienpass.nrw.de bestellt werden.Die beteiligten Institutionen sind sich darin einig, dass nurwer medienkompetent ist, die Chancen ausschöpfen kann,die Medien für eine verantwortliche Teilhabe am gesellschaftlichenLeben bieten. In diesem Sinne haben dieVorbereitungen <strong>zum</strong> Medienpass NRW für die Klassen 7 bis9 bzw.10 bereits begonnen. Die Initiative will am bewährtenKonzept festhalten und ab Februar 2014 wie<strong>der</strong>um einePilotphase durchführen, um Praxiserfahrungen zu sammelnund einzubeziehen. Dann soll auch die Möglichkeit<strong>der</strong> Dokumentation mit Hilfe eines digitalen Medienpasseserprobt werden.Dagmar MissalDagmar Missal ist pädagogische Mitarbeiterin bei <strong>der</strong>Medienberatung NRW.13
MEDIENBRIEF | N° 02.2013Tablet-Computerin den MINT-FächernÜber Chancen und Risiken dieser TechnikUnterrichten mit Tablet-Computern bedeutet Lernen auf <strong>der</strong> Höhe <strong>der</strong> Zeit – so <strong>zum</strong>indest die weitläufige Meinung.Doch warum sollten Tablet-Computer tatsächlich einen Mehrwert für das Lernen bieten? In diesem Beitrag werden dreiBeispiele vorgestellt, die einen gehaltvollen Einsatz von Tablet-Computern in den MINT-Fächern illustrieren. ImAnschluss werden diese Vorzüge aufgewogen gegenüber möglichen Risiken und Hürden, die <strong>der</strong> Einsatz von Tablet-Computern mit sich bringt.Was sind Tablet-Computer?Ich möchte Ihnen eine theoretische Einführung ersparen –jedoch gibt es zwischen Tablets immens große Unterschiede,weswegen man eigentlich nicht von Tablet-Computernim Allgemeinen sprechen darf. Tablet-Computer sind ersteinmal Computer, die primär aus einem berührungsempfindlichenBildschirm bestehen. Das Beson<strong>der</strong>e sind jedochdie Apps, also in <strong>der</strong> Regel kleine, abgegrenzte Programme,die für eine bestimmte Aufgabe ausgelegt sind. Auch hiergibt es riesige Unterschiede. Während es für Android- o<strong>der</strong>Apple-Geräte zigtausend Apps gibt, sieht es bei an<strong>der</strong>enBetriebssystemen eher schwach aus. Programme fürSchreibtisch-Computer können in <strong>der</strong> Regel nicht installiertwerden. Tablets verfügen meist über eine Kamera undeinen Browser, mit dem man Webseiten besuchen kann.Die im Folgenden beschriebenen Beispiele wurden mitApple- o<strong>der</strong> Samsung-Geräten (Android-Betriebssystem)realisiert.Video-AnalyseNatürlich gibt es Video-Analyse schon seit zig Jahren. Wersie schon einmal im Unterricht durchgeführt hat, weiß aberauch, wie aufwendig die Durchführung ist. Die aktivierendeSchülereinbindung ist dabei schwierig – in <strong>der</strong> Regel wurdeein Video erstellt und dann gemeinsam ausgewertet.Verfügt ein Kurs über Tablet-Computer und eine App wieVernier-Video-Physics (vgl. Pallack, 2013, 28f), bieten sichneue Möglichkeiten. Die Wichtigste ist wohl, dass dieLernenden die Experimente ohne großen Aufwand selbstdurchführen können. Das hat große Vorteile: Lehrkräftekennen die wichtigen Handgriffe, damit Experimentegelingen. Sind die Schülerinnen und Schüler nur Zuschauer,können sich die gefor<strong>der</strong>ten Kompetenzen <strong>zum</strong> Experimentierennur eingeschränkt entwickeln. Bei Fallversuchenim Physikunterricht o<strong>der</strong> Bewegungsanalysen im Mathematikunterrichtkönnen sich Lernende <strong>zum</strong> einen selbsterproben, <strong>zum</strong> an<strong>der</strong>en erhalten Lehrkräfte aber – an<strong>der</strong>sals bei vielen an<strong>der</strong>en Schülerexperimenten – auch Einblick,wie die Experimente durchgeführt wurden undkönnen darüber mit <strong>der</strong> Lerngruppe diskutieren.MediencollagenTafel, Buch und Heft sind die klassischen Medien imUnterricht. Tatsächlich ist das nicht ohne Grund so: Siefunktionieren zuverlässig und sind in <strong>der</strong> Regel universellverwendbar. Nachteilig ist, dass sich die eigenen Aufzeichnungenauf Texte und Skizzen beschränken. Das eigentlichespannende Experiment, z. B. die überraschende Reaktionim Chemieunterricht o<strong>der</strong> das Zufallsexperiment imMathematikunterricht, kann nur umschrieben werden. DieInhalte von Internetseiten könnten zwar ausgedruckt undeingeklebt werden – aber ist das wirklich sinnvoll? O<strong>der</strong> wiehält man seine Entdeckungen fest, die man mit HilfeDynamischer-Geometrie-Software gemacht hat?Für Tablet-Computer gibt es dafür Apps, die es erlauben,Medienkollagen zu erstellen (vgl. Kracht 2013). So findetman den YouTube-Film verlinkt neben den eigenen Aufzeichnungen,das Interview mit dem Wissenschaftler ist nureinen Fingertipp entfernt und die handschriftliche Tabellefindet man ebenfalls als Bild neben <strong>der</strong> Auswertung. Kurz:14
01 | LERNEN MIT DIGITALEN MEDIENMan erhält ein authentisches Dokument, das den Prozessdeutlich besser abbildet, als es jede handschriftlicheAufzeichnung könnte.Asynchrone und synchrone Kommunikationsie bei Google-Docs erstellen kann, können Live-Umfragendurchgeführt werden. So besteht die Möglichkeit, dassLernende anonym votieren – aber auch Ergebnisse, <strong>zum</strong>Beispiel aus Experimenten, können so schnell und komfortabelverglichen werden.Was ist eine »runde« Stunde? Es gibt einen gelungenenEinstieg, die Lernenden erarbeiten sich neue Inhalte, diedann final gesichert werden. Doch wie geht man damit um,wenn viele verschiedene Ergebnisse vorliegen? Werden Tablet-Computerim Verbund mit einem Whiteboard und einemfunktionalen Netzwerk verwendet, können Daten sehrschnell ausgetauscht und gesammelt werden. Man kannsogar noch einen Schritt weiter gehen und synchronkommunizieren: Mit Hilfe von Online-Formularen, wie manAn<strong>der</strong>e Seiten <strong>der</strong> MedailleEs gibt viele Aspekte, die hier angesprochen werdenkönnten. Neben <strong>der</strong> Akkuleistung, <strong>der</strong> Herausfor<strong>der</strong>ung <strong>der</strong>Installation von Updates, <strong>der</strong> Gefahr von Diebstahl undVandalismus, räumlichen Voraussetzungen o<strong>der</strong> <strong>der</strong>Bedienungsumstellung gibt es <strong>zum</strong> einen rechtliche und<strong>zum</strong> an<strong>der</strong>en pädagogische Gründe, den Einsatz vonTablet-Computern mit viel Muße und Umsicht zu beginnen.Foto: Tom Morris15
MEDIENBRIEF | N° 02.2013UrheberrechtsverletzungenTexte, Videos, Bil<strong>der</strong> sind in <strong>der</strong> Regel urheberrechtlichgeschützte Materialien. Eine Medienkollage zu erstellenund diese Dokumente via Plattform online zu streuen, kannsehr schnell zu rechtlichen Problemen führen. Wie sollenLernende hier unterscheiden, was erlaubt ist und wasnicht? Und wissen Lehrerinnen und Lehrer eigentlich, anwelcher Stelle Grenzen überschritten werden? Hier bestehtsicher Informations- und auch Fortbildungsbedarf.AblenkungspotenzialUm Tablet-Computer sinnvoll nutzen zu können, benötigtman in <strong>der</strong> Regel einen Internetzugang. Setzen die Lernendeneigene Geräte ein, sind dort natürlich auch Spiele o<strong>der</strong>Programme zur Kommunikation in sozialen Netzwerkeninstalliert. Die Möglichkeit, blitzschnell zwischen Apps zuwechseln o<strong>der</strong> sich sogar live mit den neuesten Nachrichtenversorgen zu lassen, ist verführerisch.Ich habe in einigen Kursen, die Tablet-Computer einsetzen,anonymisierte Befragungen mit <strong>der</strong> Unterstützung vonStudierenden durchgeführt (siehe dazu <strong>zum</strong> Beispiel Götte& Bentrup, 2013). Das Ergebnis ist ernüchternd: Rund dieHälfte fühlt sich durch die Möglichkeit, auf einen Tablet-Computer zugreifen zu können, abgelenkt. Einige Lernendebeschreiben, dass auch bei nüchternen Anwendungen dieKommunikationsplattform nur einen Tipp weit entfernt ist;das reizt und führt zur Ablenkung. In dem von Götte &Bentrup beschriebenen Kurs wurden auch digitalisierteSchulbücher eingesetzt. Im Heimbereich arbeiteten diemeisten Lernenden, auch wegen <strong>der</strong> Ablenkungsgefahr,mit einem gedruckten Schulbuch.FazitNatürlich gibt es für alles Lösungen: Urheberrechtsverletzungenkann man durch Schulungen umgehen und umAblenkung zu vermeiden, gibt es Managementsysteme.Jedoch nimmt das Geräten wie Tablets die Unbeschwertheit:Ihr Vorteil ist doch gerade, dass sie je<strong>der</strong>zeit verfügbarund einsetzbar sind. Wie geht man nun damit um: Ersteinmal alle Probleme aus dem Weg räumen und den Tablet-Einsatz solange auf Eis legen?Ich denke, man sollte das eine tun, ohne das an<strong>der</strong>e zulassen. Schule muss sich notwendig mit dem technischenFortschritt auseinan<strong>der</strong>setzen und erörtern, wo pädagogischePotenziale o<strong>der</strong> Gefahren lauern. Dazu gehört auch,neue Dinge auszuprobieren und für den Lernprozessnutzbar zu machen. Wenig zukunftsweisend erscheinenjedoch Ansätze, die alles auf die Karte Tablet-Computersetzen. In Deutschland befinden wir uns nach wie vor in <strong>der</strong>Pilotphase: Es gibt nur sehr wenige belastbare Ergebnisse<strong>zum</strong> Lernen mit Tablet-Computern. Meine Prognose ist,dass die Technik von heute aus gesehen in spätestens acht,vielleicht sogar schon in fünf Jahren überholt ist – einigeFunktionalitäten werden sich pädagogisch bewähren unddarauf kann man wie<strong>der</strong> aufbauen. Die rasante technischeEntwicklung führt uns vor Augen, wie zentral es ist, sichdauerhaft auf das zu konzentrieren, was wichtig ist:Lernprozesse bei Schülerinnen und Schülern zu för<strong>der</strong>n.Dr. Andreas PallackOStD Dr. Andreas Pallack leitet das Franz-Stock-Gymnasiumin Arnsberg. Vorher war er Fachleiter und in zahlreicheProjekte rund um das Lernen mit digitalen Medien eingebunden.Seine jüngste Publikation »Unterrichten mitTablet-Computern« ist im Verlag Klaus-Seeberger erschienenund kann unter www.mnu.de bestellt werdenDiese Ergebnisse konnten mittlerweile repliziert werden –ich stelle deswegen die These auf, dass sich gut die Hälfte<strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler, die mit einem eigenenTablet-Computer ausgestattet ist, von dem Gerät beimLernen ablenken lässt.LiteraturGötte, Klara und Bentrup, Max (2013) Nützlich, motivierend, zeitraubend – wie Schülerden Einsatz von Tablets beurteilen. In: Unterrichten mit Tablet-Computern,Anna-Kristin Kracht und Andreas Pallack (Hrsg.). Verlag Klaus Seeberger, Neuss. S.62-67.Kracht, Anna-Kristin (2013) Mit Tablets Medienkollagen erstellen. In: Unterrichten mitTablet-Computern, Anna-Kristin Kracht und Andreas Pallack (Hrsg.). Verlag KlausSeeberger, Neuss. S. 36-39.Pallack, Andreas (2013) Vernier Video-Physics. In: Unterrichten mit Tablet-Computern,Anna-Kristin Kracht und Andreas Pallack (Hrsg.). Verlag Klaus Seeberger,Neuss. S. 28-29.16
01 | LERNEN MIT DIGITALEN MEDIENUnd darüber hinaus…Es darf auch gespielt werden und esgibt zahlreiche Spiele, die Konzentration,Fein- und Grobmotorik, Gedächtniso<strong>der</strong> kognitive Prozesse för<strong>der</strong>n. VieleSpiele machen einfach nur Spaß,bieten aber für unsere Schülerinnenund Schüler zusätzliche Möglichkeitenz. B. zur För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Feinmotorikwie <strong>der</strong> Beidhandkoordination o<strong>der</strong> zurAuge-Hand-Koordination.Foto: JoeInQueensAls eine <strong>der</strong> ersten För<strong>der</strong>schulen inNRW setzen wir in <strong>der</strong> Jordan-Mai-Schule in Essen das iPad seit 2011 ein.Wir sind eine För<strong>der</strong>schule mit demSchwerpunkt »Geistige Entwicklung«in <strong>der</strong> Trägerschaft des Bistums Essenund unterrichten Schüler und Schülerinnenzwischen sechs und zwanzigJahren mit sehr unterschiedlichenkognitiven Beeinträchtigungen. Dasbedeutet, dass wir eine sehr heterogeneSchülergruppe unterrichten. Diese»Vielfalt« findet ihre Entsprechung insehr differenzierten und individualisiertenUnterrichtsangeboten, beidenen diejenigen, bei welchen dasiPad eingesetzt werden darf, die mitAbstand beliebtesten sein dürften.Mittlerweile sind alle Klassen undeinzelne Fachkurse mit einem iPadausgestattet. Bestimmte Apps sind alsGrundeinstellung auf allen GerätenRendezvous imApple-StoreDie erste Begegnung mit dem iPad 1 im Apple-Store in Oberhausen war <strong>der</strong>Impuls, ein iPad mit in die Schule zu bringen und herauszufinden, ob auchunsere Schülerinnen und Schüler einer För<strong>der</strong>schule problemlos mit demGerät umgehen können, wie es <strong>der</strong> erste Anschein versprach.installiert, eine Liste weiterer sinnvollerApplikationen verwalten wir übereine Datensammlung in <strong>der</strong> Cloud.Kernbereiche Unterricht:Seit mehr als zehn Jahren haben wirkompetenzorientierte Unterrichtsformenetabliert: Stationsverfahren,»Lerntheke« o<strong>der</strong> »Lernbuffet«sichern selbstbestimmte und selbstorganisierteSchülerarbeit. Das iPadwird hier als Werkzeug genutzt. Esfällt immer wie<strong>der</strong> auf, wie motivierenddas Arbeiten mit den iPads istund welche überraschenden LernerfolgeSchülerinnen und Schülererzielen, <strong>der</strong>en Lernerfahrung durchhäufige Misserfolge geprägt war.Im Rahmen ihres Medienkonzepteshat sich die Schule gegen einenComputerraum entschieden. DieMöglichkeiten des Computers müssenerreichbar sein, wenn sich dies alsnotwendig erweist. Ein weit abgelegenerund dann vielleicht besetzterComputerraum nützt da nichts.Darüber hinaus sehen wir eine weiterebemerkenswerte Entwicklung: MobileDevices nehmen einen immer breiterenRaum ein, »Facebook« und»WhatsUp«, »iTunes« und »iPods«werden auch von unseren Schülerinnenund Schülern aktiv genutzt.Hilfreiche – in unregelmäßigenAbständen aktualisierte – Listen mitempfehlenswerten Apps finden Sie imInternet auf www.cluks-forum-bw.de.CLUKS steht für »ComputergestütztesLernen und Unterstützte Kommunikationfür Schülerinnen und Schüler miteiner körperlichen/geistigen Behin<strong>der</strong>ung«.Michael Brieler-JödeckeMichael Brieler-Jödecke ist Lehrer an<strong>der</strong> Jordan-Mai-Schule, För<strong>der</strong>schulemit dem Schwerpunkt GeistigeEntwicklung, in 45966 Gladbeck,www.jordan-mai-schule.de17
MEDIENBRIEF | N° 02.2013WASSER - ein Klassikerim neuem (iBook-)GewandÜberzeugt davon, dass <strong>der</strong> Einsatz von interaktiven Büchern (z. B. iBooks) im Unterricht <strong>der</strong> Grundschule kompetenzorientiertes,selbstständiges, differenziertes sowie nachhaltiges Lernen in hohem Maße ermöglicht, entwickelte icheine multimediale Unterrichtsreihe im Fach Sachunterricht <strong>zum</strong> Thema Wasser. Dank <strong>der</strong> Unterstützung <strong>der</strong> MedienLBGmbH (Medien für Lehrpläne und Bildungsstandards), die mir sowohl digitale Medien (Filme, Fotos) als auch analogesArbeitsmaterial <strong>zum</strong> Thema Wasser zur Verfügung stellte, entstand ein 20-seitiges iBook, das in verschiedenenKapiteln unter an<strong>der</strong>em Themen wie »Der Wasseranteil«, »Der Wasserkreislauf«, »Das Trinkwasser«, »Die Kläranlage«sowie »Die Wasserzustände« beinhaltete. Parallel dazu erhielten die Schülerinnen und Schüler ein von mir <strong>zum</strong>iBook konzipiertes Arbeitsheft mit thematischen Aufgaben, die sie mit Hilfe des im Rahmen dieser Unterrichtsreiheerworbenen Wissens bearbeiten konnten.Wie zu Beginn einer jeden Unterrichtsreiheim Fach Sachunterricht,erstellten die Schülerinnen undSchüler – wahlweise digital o<strong>der</strong>analog – eine individuelle Mindmap,um sich in einem ersten Schritt aufdas Thema einzulassen und um deneigenen Wissenstand zu visualisieren.Erst dann setzten sich die Kin<strong>der</strong>selbstständig und in ihrem individuellenTempo mit den für sie zusammengestelltenInhalten sowie Aufgabendes iBooks, welche unterschiedlicheLerntypen, Methoden und Medienberücksichtigten, auseinan<strong>der</strong>.Zunächst erhielten sie auf <strong>der</strong> erstenSeite ihres digitalen Buches anhandeines kurzen Filmbeitrags eineallgemeine thematische Einführung.Sie erfuhren beispielsweise, dass sich<strong>der</strong> größte Anteil des Wassers alsSalzwasser in den Weltmeerenbefindet und nur ein geringer Anteilals Süßwasser für den Menschengenießbar ist.Direkt im Anschluss überprüften dieSchülerinnen und Schüler ihr hinzugewonnenesWissen in einem <strong>zum</strong> Filmentwickelten digitalen Quiz imMultiple-Choice Format. Sie erhielteneine sofortige Rückmeldung hinsichtlichihrer richtig bzw. falsch gelöstenAufgaben, die sie dann ggf. erneutbearbeiten konnten.Auf <strong>der</strong> nächsten Seite des WasseriBooksinformierten sich die Schülerinnenund Schüler über den Wasseranteilausgewählter Lebewesen undPflanzen. Mit Hilfe von in einerBil<strong>der</strong>galerie hinterlegten Bil<strong>der</strong>nerkannten sie schnell, welchenLebewesen das Wasser sprichwörtlichbis <strong>zum</strong> Hals steht.Beson<strong>der</strong>s eindrucksvoll wurde ineinem nächsten Schritt <strong>der</strong> Wasserkreislaufsowohl über einen Film alsauch über Hyperlinks, welche dieSchülerinnen und Schüler mitinhaltlich sehr kindgerecht aufbereitetenInternetseiten verlinkte,thematisiert, erklärt und schrittweiseveranschaulicht. Um die einzelnenPhasen des Wasserkreislaufeskonkret nachvollziehen zu können,wurden die Schülerinnen und Schülerin ihrem iBook im Rahmen einerdigitalisierten Versuchsdurchführungangeleitet, einen eigenen Wasser-kreislauf zu erzeugen. Dazu schichtetensie in Kleingruppen zunächstetwas Holzkohle in ein Glas, daswie<strong>der</strong>um zu einem Drittel mitPflanzenerde gefüllt wurde.Anschließend pflanzten sie einenkleinen Ableger hinein, feuchteten dieErde mit etwas Wasser an undspannten ein Stück durchsichtige Foliemit einem Gummi über das Glas.Sowohl ihre Vermutungen als auchihre Beobachtungen hielten dieSchülerinnen und Schüler im Rahmeneines Versuchsprotokolls in ihremArbeitsheft fest. Parallel dazu dokumentiertensie ihre Beobachtungenaber auch mit <strong>der</strong> Kamera des iPads.Schon am nächsten Tag konnten siebeobachteten, wie die Wassertropfen,die sich an <strong>der</strong> durchsichtigen Foliedurch die Verdunstung sammelten,hinunter tropften und die Erde ohnezusätzliches Wassers feucht hielten,so dass die Pflanze weiterhin versorgtwurde und wachsen konnte. Anschließendüberprüften die Schülerinnenund Schüler ihr hinzugewonnenesWissen auf <strong>der</strong> nächsten Seite ihresiBooks, indem sie einem Bild eines18
01 | LERNEN MIT DIGITALEN MEDIENWasserkreislaufes interaktiv dierichtigen Textabschnitte zuordneten.Auf den nächsten Seiten des iBookswurden nun Fragen wie »Wie kommtdas Wasser als Grundwasser unterdie Erde?«, »Woher kommt unserTrinkwasser?« o<strong>der</strong> »Wie viel LiterWasser verbraucht eine Persontäglich?« geklärt. Antworten daraufwurden den Schülerinnen undSchülern <strong>zum</strong> einen im Rahmen einesFilms zur Trinkwassergewinnung und<strong>zum</strong> an<strong>der</strong>en durch Scrolltexte mitthematischen Bil<strong>der</strong>n angeboten.Auch Aufgaben, in denen sie interaktivZuordnungen vornehmen o<strong>der</strong>Textteile in die richtige Reihenfolgebringen mussten, taten ihr Übriges,um sich das erfor<strong>der</strong>liche Wissenunter Berücksichtigung verschiedenerSinneskanäle und Zugangsweisenanzueignen.Hinsichtlich des Aufbaus einerKläranlage informierten sich die Schülerinnenund Schüler mit Hilfe vonPopover-Texten, die auf Wunsch überden einzelnen Bildausschnittenerschienen, in erster Linie darüber,was in den einzelnen Becken <strong>der</strong>Kläranlage geschieht. Weiterhinkonnten sie den Weg des Wasserssowohl im Rahmen eines virtuellenRundgangs durch eine Kläranlage alsauch mit Hilfe <strong>der</strong> Durchführung einesVersuchs konkret nachvollziehen.Dazu schichteten die Schülerinnenund Schüler mehrere Plastikblumentöpfe,die jeweils mit grobem Kies,feinem Kies, Sand o<strong>der</strong> einer Kaffeefiltertüteversehen waren, zunächstübereinan<strong>der</strong>. Anschließend schüttetensie mit Erde und Papier verunreinigtesWasser durch ein grobes Sieb inden obersten Topf. Schnell stellten dieSchülerinnen und Schüler ersteZusammenhänge zwischen <strong>der</strong>Kläranlage und ihrem Versuchsaufbaufest und erkannten, dass letztlich dank<strong>der</strong> verschiedenen Filterschichtensauberes Wasser in den unterstenTopf tropft.Zu guter Letzt beschäftigten sich dieSchülerinnen und Schüler mit denWasserzuständen. In diesem Zusammenhangfroren sie in KleingruppenWasser in einem Plastikbecher ein,gaben das Eis in eine Schüssel undließen es tauen, um es dann schließlichauf dem Herd <strong>zum</strong> Kochen zubringen. Auch an dieser Stelleverbalisierten die Schülerinnen undSchüler ihre Vermutungen undnotierten ihre Beobachtungen imRahmen <strong>der</strong> Versuchsdurchführung inihrem Arbeitsheft. Nebenbei lerntensie, Begriffe wie gefrieren, schmelzen,Foto: Nino Barbieri19
MEDIENBRIEF | N° 02.2013verdampfen und kondensieren denunterschiedlichen Wasserzuständenrichtig zuzuordnen.Aufgaben rund um das Thema Wasserrundeten auf den letzten Seiten desiBooks die multimediale Unterrichtsreiheim Fach Sachunterricht ab.Beispielsweise suchten die Schülerinnenund Schüler digital Wasserwörterin einem Gitterrätsel, beantwortetenthematische Fragen in einem Kreuzworträtsel,erstellten eigene Keynotes(Bildpräsentationen), lasen onlineGeschichten und Bil<strong>der</strong>bücher <strong>zum</strong>Thema Wasser o<strong>der</strong> bearbeitetenabschließend ein digitales Quiz.Sowohl die während <strong>der</strong> gesamtenUnterrichtsreihe zu beobachtendeMotivation <strong>der</strong> Schülerinnen undSchüler in <strong>der</strong> Auseinan<strong>der</strong>setzungmit dem Thema Wasser als auch dieErgebnisse <strong>der</strong> im Anschluss stattfindendenLerngespräche zeigten, dasssich <strong>der</strong> Aufwand hinsichtlich <strong>der</strong>Erstellung von thematischen iBooks injedem Fall lohnt. Indem die Schülerinnenund Schüler ihr Wissen in einemweiteren Schritt in ihre zu Beginn <strong>der</strong>Unterrichtsreihe erstellte Mindmap –nun in einer an<strong>der</strong>en Farbe – ergänzten,wurde ihre Lernentwicklungebenfalls visualisiert und nachhaltigesLernen deutlich erkennbar.Aufgrund <strong>der</strong> vorgenannten positivenErfahrungen mit dem Einsatz voniBooks im Unterricht ist die Erstellungweiterer iBooks in Zusammenarbeitmit <strong>der</strong> MedienLB GmbH (Frau Dr. AnitaStangl) in Planung. Bei Rückfrageno<strong>der</strong> Interesse stehen wir gerne zurVerfügung.Andrea MuschkowskiAndrea Muschkowski ist Lehrerin an<strong>der</strong> Städtischen GemeinschaftsgrundschuleLörick in Düsseldorf.Foto: Dominik Schmitz, LVR-ZMB20
01 | LERNEN MIT DIGITALEN MEDIENVirtuelle Schreibkonferenzenmit Wiki-Technologie in <strong>der</strong>GrundschuleIm Rahmen des Unterrichtsprojekts »Virtuelle Schreibkonferenz« wurdeerprobt, inwieweit <strong>der</strong> Einsatz <strong>der</strong> Wiki-Technologie in <strong>der</strong> Grundschule einevirtuelle Zusammenarbeit von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicherSchulen ermöglicht und dadurch erfolgreiche Überarbeitungsprozesse anSchülertexten hervorgerufen werden können. Die Verbindung von Wiki-Technologieund Schreibdidaktik bietet vielfältige und umfangreiche Möglichkeitenfür das prozessorientierte und kooperative Schreiben. Dieses Projekt gibteinen ersten Einblick in Möglichkeiten, die eine virtuelle Schreibkonferenz mitWiki-Technologie in <strong>der</strong> Grundschule mit sich bringt.Die Nutzung von Wikis für dieEntdeckung von TextformenWikis können im Deutschunterricht<strong>der</strong> Grundschule als computerbasiertedidaktische Werkzeuge eingesetztwerden. Die Seiten in einem Wikiwerden über das WWW gelesen undlassen sich direkt im Internet bearbeiten.Dabei werden Kommunikation,Zusammenarbeit und Interaktionunterstützt. Auch wenn die Kin<strong>der</strong>keine Vorkenntnisse haben, sind sienach einer kurzen Einführung in <strong>der</strong>Lage, Wiki-Texte zu schreiben und zuverän<strong>der</strong>n. Die Erfahrung hat gezeigt,dass sich das Erstellen von eigenenSteckbriefen beson<strong>der</strong>s gut als erstepraktische Übung eignet, um diewiki-eigene Schreibweise kennenzulernenund u .a. um die Schüler aneine kompetente Mediennutzung- und–gestaltung heranzuführen 1 . Bei <strong>der</strong>Nutzung von Wikis im Schreibunterrichtwerden sowohl Ergebnisse alsauch Prozesse <strong>der</strong> Entstehungreflektiert. Diese Art des Lernensermöglicht ein persönliches, individuellesLernen, aber auch Engagementin einer Lerngruppe 2 . Aufgrund <strong>der</strong>Potenziale <strong>der</strong> Wiki-Technologie, bietetsie sich für einen von selbstständigemund eigenaktivem Lernen geprägtenSchreibunterricht an. Zwei Grundbausteinevon Wikis sind dabei für die1 vgl. Anskeit, Nadine (2012): WikiWiki in die Schule.Unterrichtsbeispiele und Praxiserfahrungen <strong>zum</strong>Einsatz von Wikis in <strong>der</strong> Schule. In: Beißwenger,Michael; Anskeit, Nadine; Storrer, Angelika (Hrsg.,2012): Wikis in Schule und Hochschule. Boizenburg:Verlag Werner Hülsbusch (Reihe »E-Learning«), 13-46.2 vgl. Himpsl, Klaus (2007).: Wikis im BlendedLearning. Ein Werkstattbericht. Boizenburg.Begleitung von Schreibprozessenzentral: die Diskussionsseiten und dieVersionenverwaltung. Zu je<strong>der</strong>Artikelseite im Wiki gibt es eineDiskussionsseite. Die Nutzer greifenauf diese Seite zu, um Rückmeldungenund Anregungen zu einem Text zugeben. Die Versionenverwaltungerlaubt es den Benutzern, verschiedeneVersionen eines Textes anzuzeigen,frühere Versionen wie<strong>der</strong>herzustellenund auch zwei Versionen miteinan<strong>der</strong>zu vergleichen, wodurch Überarbeitungsprozessesichtbar gemachtwerden 3 . Eine Lernumgebung, in <strong>der</strong>die jungen Schreiber von an<strong>der</strong>enKin<strong>der</strong>n Anregungen, Ermutigungenund Tipps für die Überarbeitung ihrerTexte erhalten, ermöglicht eineauthentische und intensive Auseinan<strong>der</strong>setzungmit Texten, die nichtprimär das Ziel hat, Texte für denLehrer zu verfassen 4 . Im Unterrichtsprojektwird <strong>der</strong> Einsatz <strong>der</strong>virtuellen Schreibkonferenz an dieTextform <strong>der</strong> Beschreibung geknüpft.Die Schreibkonferenz wird hierbeiauch dazu genutzt, das zunächstimplizite Wissen über bestimmteTextmuster durch praktische Erfahrungenzu einem Handlungswissen3 vgl. Beißwenger, Michael & Angelika Storrer (2010):Kollaborative Hypertextproduktion mit Wiki-Technologie.Beispiele und Erfahrungen im Bereich Schule undHochschule. In: Eva-Maria Jakobs, Katrin Lehnen &Kirsten Schindler (Hrsg.): Schreiben und Medien.Schule, Hochschule, Beruf. Frankfurt: Peter Lang (Textproduktionund Medium 10),13–36.4 Spitta, Gudrun (1992): Schreibkonferenzen in Klasse3 und 4. Ein Weg vom spontanen Schreiben <strong>zum</strong>bewussten Verfassen von Texten. Frankfurt am Main:Cornelsen Verlag Scriptor GmbH & Co.KG.21
MEDIENBRIEF | N° 02.2013Foto: Nicole Schäfer, LVR-ZMBwerden zu lassen 5 . Das Überarbeitenan »engen« Textmustervorgaben zuüben, wirkt sich positiv auf dieRevisionen <strong>der</strong> Schüler aus und sollim Rahmen des Unterrichtsprojekteseinen neuen, kreativen und vor allemeffektiven Zugang <strong>zum</strong> Schreibprozessermöglichen.Unterrichtsprojekt»Virtuelle Schreibkonferenz«Im Folgenden werden die sechsUnterrichtsphasen 6 des Projektsdargestellt, bevor die Erfahrungen aus<strong>der</strong> Unterrichtspraxis geschil<strong>der</strong>twerden.5 Fix, Martin (2006): Texte schreiben. Schreibprozesseim Deutschunterricht. Pa<strong>der</strong>born.6 Dem Schreibprojekt wird eine Wiki-Einführungvorangestellt. Eine ausführliche Beschreibung <strong>der</strong>Wiki-Einführung und aller Unterrichtsphasen mit<strong>Download</strong>option für die Arbeitsblätter findet sich inAnskeit, Nadine (2012): WikiWiki in die Schule.Unterrichtsbeispiele und Praxiserfahrungen <strong>zum</strong>Einsatz von Wikis in <strong>der</strong> Schule. In: Beißwenger,Michael; Anskeit, Nadine; Storrer, Angelika (Hrsg.,2012): Wikis in Schule und Hochschule. Boizenburg:Verlag Werner Hülsbusch (Reihe »E-Learning«), 13-46.Phase 1: ZimmerbeschreibungDie Schüler bekommen gemeinsammit einem Partner den Auftrag, dasPlaymobil-Zimmer einzuräumen undes anschließend in Einzelarbeit imWiki zu beschreiben. Für die Beschreibungbekommen sie keine Vorgaben.Sie haben die Möglichkeit, ihreTexterstfassung frei zu gestalten,Phase 2: Zimmer nachbauenIn Partnerarbeit lesen die Schülergemeinsam die Texte ihrer jeweiligenKonferenzpartner <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Schuleund versuchen, die entsprechendenZimmer nachzubauen. Während desNachbaus notieren sie erste Eindrücke,wobei sie ein beson<strong>der</strong>es Augenmerkauf die Vollständigkeit <strong>der</strong>Beschreibung sowie die Charakterisierungund Lokalisierung <strong>der</strong> einzelnenMöbelstücke legen. Im Anschluss anden Nachbau <strong>der</strong> Zimmer werden dieErgebnisse im Plenum besprochen.Durch die beim Nachbau gesammeltenEindrücke und entstandenenProbleme erkennen die Schülerwesentliche Merkmale einer Zimmerbeschreibungund benennen diese miteigenen Worten. Am Ende <strong>der</strong> Stundewerden die zentralen Merkmale inForm eines Kriterienkatalogs zusammengestellt.Phase 3: Lob und SchreibtippsformulierenIm Rahmen <strong>der</strong> dritten Unterrichtseinheitsetzen sich die Schüler erneut mitden Texten ihrer Konferenzpartnerauseinan<strong>der</strong> und formulieren anhanddes Kriterienkatalogs gemeinsam mitihrem Partner <strong>der</strong> eigenen Schule Lobund Schreibtipps für den Konferenzpartner.Da dieses metakommunikativeVorgehen auf schriftlicher Ebeneeine sehr hohe Anfor<strong>der</strong>ung an dieSchüler stellt, wird beson<strong>der</strong>s großerWert auf die Zusammenarbeit <strong>der</strong>beiden Schüler innerhalb einer Klassegelegt. Der Nachbau des Zimmerswird zudem fotografiert und anschließendauf die Diskussionsseite desKonferenzpartners gestellt.22
01 | LERNEN MIT DIGITALEN MEDIENPhase 4: Die eigenen TexteüberarbeitenPhase 5: Erneuter NachbauErfahrungen aus <strong>der</strong>UnterrichtspraxisIm Rahmen <strong>der</strong> vierten Einheit <strong>der</strong>Unterrichtsreihe beschäftigen sich dieSchüler mit ihren eigenen Texten undlernen, diese im Wiki zu überarbeiten.Zusätzlich zu einer kurzen Anleitung,wie die Überarbeitung geplant unddurchgeführt werden kann, bekommensie das Originalbild und das Bildvom Nachbau ihres Zimmers alsArbeitsblatt ausgeteilt. Mithin könnensie einen Vergleich ihres Originalzimmersmit dem Nachbau <strong>der</strong> Konferenzpartneranstellen und sichzugleich Stellen und Möbel im Bildmarkieren, die sie noch einmalüberarbeiten möchten. Zusätzlich zuden Schreibtipps <strong>der</strong> Konferenzpartnerbekommen die Schüler für dieletzte Unterrichtsstunde <strong>der</strong> ÜberarbeitungKommentare von <strong>der</strong> Lehrperson.Durch abschließende farblicheGestaltung o<strong>der</strong> das Hinzufügen vonGrafikelementen, Textumrandungenetc. machen die Schüler den Abschlussihres Schreibprozessesdeutlich und stellen die letzte Textversionals Textendfassung im Wiki ein.Abbildung: Das OriginalzimmerInhalt <strong>der</strong> fünften Phase ist zunächstdie Kontrolle <strong>der</strong> Überarbeitungen desKonferenzpartners. Auf spielerischeArt prüfen die Schüler, ob eineVerbesserung <strong>der</strong> Textqualität erreichtwerden konnte, indem sie die Zimmerihrer Konferenzpartner erneutnachbauen. Zum Vergleich vonNachbau und Originalzimmer habensie durch die »Verstecken undAnzeigen«-Funktion die Möglichkeit,auf <strong>der</strong> Seite <strong>der</strong> Zimmerbeschreibungim Wiki das Originalbild des Zimmersanzeigen zu lassen, nachdem sie denNachbau fertig gestellt haben. Einabschließen<strong>der</strong> Kommentar auf <strong>der</strong>Diskussionsseite bildet den Abschluss<strong>der</strong> Konferenz.Phase 6: Dichterlesung /AbschlussbesprechungDie Schüler bei<strong>der</strong> Klassen treffen fürdie Dichterlesung in einer <strong>der</strong> beidenSchulen aufeinan<strong>der</strong>. Sie lernen ihreKonferenzpartner kennen undgemeinsam bilden sie Gruppen vonjeweils vier Schülern. In den Kleingruppenhaben die Schüler Zeit füreinen persönlichen Austausch,bekommen aber auch die Aufgabe,sich gegenseitig ihre Zimmerbeschreibungenin Text und Bild noch einmalvorzustellen. Anschließend wählt dieGruppe schließlich die beste Beschreibungaus, um diese bei <strong>der</strong> Dichterlesungvorzutragen. Der Autor <strong>der</strong>ausgewählten Beschreibung stelltzunächst sich und seinen Konferenzpartnervor und beide präsentierendann gemeinsam die Zimmerbeschreibung.Anhand des Unterrichtsprojekts konntegezeigt werden, dass Grundschülereiner dritten Jahrgangsstufe in <strong>der</strong>Lage sind, ihre Texte in einer aufWiki-Technologie basierenden virtuellenSchreibkonferenz so zu überarbeiten,dass <strong>der</strong> Vergleich von Texterst- undTextendfassung eine Verbesserung <strong>der</strong>Textqualität aufzeigt 7 . Trotz <strong>der</strong>Tatsache, dass die Schüler die Nutzung<strong>der</strong> Wiki-Technologie zunächsterlernen mussten, haben sie sich sehrschnell mit dem Medium vertrautgemacht und konnten mithilfe <strong>der</strong>Technologie eine erfolgreiche virtuelleSchreibkonferenz durchführen.Die Erfahrung aus dem dargestelltenUnterrichtsprojekt zeigt, dass Wikis –bei geeigneter didaktischer Rahmung– sich gut als zusätzliches didaktischesWerkzeug in den Unterrichtsalltagintegrieren lassen.Teamarbeit mit Wikis eröffnet dem(Deutsch-) Unterricht eine Reiheattraktiver neuer Möglichkeiten.Darüber hinaus legen die Schüler bei<strong>der</strong> Arbeit mit dem Medium Computereine hohe Motivation an den Tag, wasden produktiven und zielgerichtetenLernprozess noch zusätzlich unterstützt.Nadine Anskeit7 Anskeit, Nadine (2010): Virtuelle Schreibkonferenzenmit Wiki-Technologie in <strong>der</strong> Grundschule. M.A.-Arbeit,TU Dortmund.Nadine Anskeit ist wissenschaftliche Mitarbeiterinund Dozentin im Bereich Deutsche Sprache undSprachvermittlung am Institut für deutsche Spracheund Literatur <strong>der</strong> TU Dortmund. Beim diesjährigenExaMedia NRW-Wettbewerb gewann sie im BereichExaMedia NRW Studium den ersten Preis.23
MEDIENBRIEF | N° 02.2013Vielfalt inklusiveMobile Endgeräte im Einsatz in <strong>der</strong> Sekundarstufe IMobile Endgeräte sind im Alltag von Schülerinnen und Schülern in vielfältigen Formen anzutreffen, sind sie doch durchihre Kompaktheit und intuitive Bedienungsoberfläche sehr benutzerfreundlich. Smartphone, Mp3-Player mit Touchscreeno<strong>der</strong> als größerer Tablet-PC – es wun<strong>der</strong>t nicht, dass sich diese Medien auch in so manchem Schulranzenwie<strong>der</strong>finden. Medien, die Schülerinnen und Schüler privat nutzen, bringen sie häufig auch (ungefragt) mit in dieSchule, entwe<strong>der</strong>, um Mitschülerinnen und Mitschüler zu beeindrucken o<strong>der</strong> eben, weil sie Vorzüge in <strong>der</strong> Arbeit mitdiesem Medium erkannt haben. Die Institution Schule kann diese Medien nun in ihrer Verwendung einschränken o<strong>der</strong>selbige für die Verbesserung von Lernwegen nutzbar machen. Ob als mitgebrachtes Medium im Rahmen von »BringYour Own Device«, welches natürlich soziale Fragen <strong>der</strong> Ungleichheit aufwirft, ob als einzelne Medien im Klassenraumo<strong>der</strong> als ganzer Medienwagen. Die denkbaren Einsatzmöglichkeiten in schulischen Zusammenhängen sind vielfältig.Sich mit den technischen und sozialenBedingungen des Einsatzes vonmobilen Endgeräten zu befassen, wäresicher einen eigenen Artikel wert. Von<strong>der</strong> Einbindung in schulische Netzwerkebis hin zur Wartung o<strong>der</strong> zurDiskussion <strong>der</strong> Betriebssoftwareeröffnet sich ein breites Spektrum. Esgeht hier aber vielmehr um dieVorstellung und Diskussion <strong>der</strong>vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, diesich in ihrer Palette deutlich vonan<strong>der</strong>en Medien unterscheiden.Am interessantesten präsentiert sich<strong>der</strong> Einsatz von Tablet-PCs imUnterricht, die ja in <strong>der</strong> Bedienungeinem Smartphone sehr ähnlich, aberdurch das größere Display wesentlichbedienungsfreundlicher sind. Hier<strong>zum</strong>öchte ich ein paar praxisnaheEinsatzfel<strong>der</strong> vorstellen. Diese sind inihren Anwendungen und Beispielenunabhängig von spezifischen Fächernzu sehen, gibt es viele fächerübergreifendePerspektiven und ich verstehevielmehr Tablet-PCs in ihrer VielfaltFoto: Dominik Schmitz, LVR-ZMB24
MEDIENBRIEF | N° 02.2013»Handys raus!«Zum Umgang mit mobilen Netzwerken in SchulenMo<strong>der</strong>ne schülerzentrierte, produktorientierte und den Herausfor<strong>der</strong>ungen<strong>der</strong> Inklusion gerecht werdende Lernszenariensetzen auf den Einsatz von multimedialen Lernmitteln,die über Arbeits- und Kommunikationsplattformen aufmobilen, internetfähigen Endgeräten zu je<strong>der</strong> Zeit an jedemOrt verfügbar gemacht werden. Ein Schlüssel zur Umsetzungsolcher Arrangements sind Funknetzwerke. Entsprechenddieser Entwicklung werden performante, kabelloseNetzzugänge von vielen Schulträgern in ihrer Medienentwicklungsplanungberücksichtigt und nicht mehr nurProjektschulen mit WLAN-Accesspoints ausgestattet.Der stetig zunehmende mobile Funkverkehr im privaten wieöffentlichen Raum und <strong>der</strong> Einzug mobiler Endgeräte wirftdie berechtigte Frage nach den Auswirkungen elektromagnetischerStrahlung auf den menschlichen Organismus auf.Netzzugänge in Schulen – wi<strong>der</strong>spricht eine solche Ausstattungnicht dem Gedanken, dass Schule ein geschützterRaum sein soll und unseren Kin<strong>der</strong>n einen gefahrlosen Wegzu Bildung ermöglichen muss? Ist es überhaupt vertretbar,Schülerinnen und Schüler wie auch Lehrkräfte in Schulenzusätzlicher Funkstrahlung auszusetzen und Bildungseinrichtungenmit WLAN-Accesspoints auszustatten?Um sich auf diesem oft emotional und polarisierenddiskutierten Gebiet eine eigene fundierte Meinung bildenund die Wirkungen elektromagnetischer Strahlungen aufden menschlichen Organismus objektiv beurteilen zukönnen, ist ein Blick auf die Bedeutung des physikalischenBegriffs »Strahlung« hilfreich.Grundsätzlich handelt es sich bei elektromagnetischerStrahlung um ein natürliches Phänomen, zu dem sichtbaresLicht ebenso gehört wie Wärmestrahlung o<strong>der</strong> Radioaktivität.Welchen Effekt Strahlung hat, hängt davon ab, wielange sie einwirkt und in welcher Entfernung sich eineStrahlungsquelle befindet. Das funkelnde Licht einesSterns erfreut uns, ein plötzlicher Fotoblitz erschreckt uns,Wärmestrahlung eines Lagerfeuers kann wohltuend sein,aber äußerst unangenehm, wenn man <strong>der</strong> Glut zu nahekommt. Sogar energiereiche radioaktive Strahlung ist inunserer Umwelt allgegenwärtig, ein Effekt <strong>der</strong> natürlichenStrahlung auf den menschlichen Organismus jedoch nichtmessbar. Die furchtbaren Auswirkungen von Langzeitexpositiono<strong>der</strong> hohen Dosen radioaktiver Strahlung sind durchHiroshima o<strong>der</strong> Tschernobyl hinlänglich bekannt.Foto: Dominik Schmitz, LVR-ZMB26
01 | LERNEN MIT DIGITALEN MEDIENDer Frequenzbereich und damit die Strahlungsenergie <strong>der</strong>eingangs genannten Mobilfunknetze liegt weit unter <strong>der</strong> vonsichtbarem Licht, physiologische Effekte hat sie dennoch.Erwähnt sei hier das Gefühl warmer Ohren bei langenTelefonaten mit Schnurlosgeräten. Für die Strahlungmobiler Geräte gilt eine einfache Regel: Die Strahlung istbei maximalem Datenverkehr am größten und nimmt mitdem Abstand <strong>zum</strong> Sen<strong>der</strong> schnell ab.Zum Schutz <strong>der</strong> Bevölkerung vor elektromagnetischerStrahlung durch Mobilfunknetze hat <strong>der</strong> Gesetzgeberverbindliche Grenzwerte festgelegt, die die dort empfohlenenHöchstwerte weit unterschreiten. Nach zahllosenStudien, u. a. durch das Bundesamt für Strahlenschutz(BfS), gibt es nach dem <strong>aktuellen</strong> Stand <strong>der</strong> Wissenschaftinnerhalb <strong>der</strong> gesetzlichen Grenzwerte keine Nachweise fürgesundheitliche Risiken. Ein vorsorglicher Umgang vorallem bei <strong>der</strong> körpernahen Anwendung von Mobilfunkgerätenist trotzdem sinnvoll. Das BfS hat deshalb Empfehlungenausgesprochen, die sich auch in <strong>der</strong> Schule umsetzenlassen.Geeignete Maßnahmen sind u. a.:> strahlungsarme Geräte einsetzen> die Sendeleistung geräteseitig an das zu versorgendeGebiet anpassen> Funknetze bei Nichtbenutzung abschalten> den Einsatz kabelgebundener Verbindungen gegenüber> Funkverbindungen vorziehen> falls möglich die angegebenen Mindestabständeeinhalten und AccessPoints möglichst entfernt vondauerhaft besetzten Arbeits- o<strong>der</strong> Aufenthaltsplätzeninstallieren> Mobilfunkgeräte möglichst nicht am Körper haltenBei <strong>der</strong> Planung von großen WLAN-Netzen ist es ratsam,den Schulträger einzubeziehen, da auch bauliche Maßnahmenzu einer strahlungsärmeren Installation führenkönnen. Die kommunalen IT-Dienstleister sind kompetenteAnsprechpartner, denn die Ausleuchtung eines Schulgebäudesmit WLAN stellt Anfor<strong>der</strong>ungen an die Accesspoints,die handelsübliche Consumer-Geräte aus dem Elektronikdiscounternicht unbedingt erfüllen.Frage, <strong>der</strong>en Potenziale werden jedoch nur dann ausgeschöpft,wenn die Schule mit einem performanten Internetzugangund WLAN-Accesspoints ausgestattet ist. Es ist alsoweniger eine Frage nach dem »ob«, son<strong>der</strong>n vielmehr nachdem »wie« <strong>der</strong> Ausgestaltung <strong>der</strong> Netzanbindungen. Eingesundheitliches Risiko geht nach <strong>der</strong>zeitigem Forschungsstandvon WLAN-Sen<strong>der</strong>n nicht aus, trotzdem kann manweitere Vorsorge treffen, indem Herstellervorgabenbeachtet und vor allem Mindestabstände zu Accesspointseingehalten werden. Auch hier sind die kommunalenIT-Dienstleister die Ansprechpartner <strong>der</strong> Wahl.Von pädagogischer Seite stellt <strong>der</strong> Unterricht mit mo<strong>der</strong>nen,digitalen Medien immer eine Ergänzung zu klassischenUnterrichtformen dar. Es gilt das Primat <strong>der</strong> Pädagogik:Digitale Technik ist kein Selbstzweck, immer muss <strong>der</strong>pädagogische Mehrwert seiner Nutzung hinterfragt werden.Keine Schule kann und will ein Internetcafé sein. Fließt dieAuseinan<strong>der</strong>setzung <strong>der</strong> Lehrkräfte mit digitalen Medien indie fachlichen Medienkonzepte ein, kommt die für denEinsatz mobiler Endgeräte notwendige Funktechnikentsprechend gezielt und dosiert zur Anwendung. Empfehlungenzur Vorsorge werden durch die wachsende Medienkompetenzernst genommen und resultieren in einerreflektierten Anwendung <strong>der</strong> Technik.Und die Handys <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler? Gehen Siedavon aus, dass diese Geräte trotz des Handyverbots anvielen Schulen dauerhaft eingeschaltet sind. In den Hosentaschenverstaut befinden sie sich in unmittelbarer Nähe zuwichtigen Organen, sodass diese einer größeren Strahlungausgesetzt sind. O<strong>der</strong> sie strahlen beson<strong>der</strong>s kräftig, weilaus den Tiefen <strong>der</strong> Schultaschen eine Verbindung <strong>zum</strong> Netzgesucht wird. Wir tun also gut daran, die Handys <strong>der</strong>Schülerinnen und Schüler auf die Tische zu holen. So sinddie Minicomputer auch je<strong>der</strong>zeit für einen begründetenunterrichtlichen Einsatz greifbar.Weitere Informationen <strong>zum</strong> Thema Strahlungsemissionfinden Sie auf den Internetseiten <strong>der</strong> Medienberatung NRW:www.medienberatung.schulministerium.nrw.de/lernit/internet+an+schulen/strahlungsemission.htmFazitDirk Allhoff/Birgit GieringDer pädagogische Nutzen des unterrichtlichen Einsatzesvon mobilen Endgeräten und Lernplattformen steht außerDirk Allhoff ist wissenschaftlicher Mitarbeiter, Birgit Gieringist wissenschaftliche Mitarbeiterin <strong>der</strong> Medienberatung NRW.27
MEDIENBRIEF | N° 02.2013eSchool:Auf neuen WegenIm März 2000 startete die Stadtverwaltung Düsseldorf das eSchool-Projekt. Ziel war, die Schulen mit mo<strong>der</strong>nenComputerausrüstungen und die Klassenräume mit Internetverbindungen auszustatten. Die Mission von eSchoolDüsseldorf ist es heute, die bestmöglichen Werkzeuge bereitzustellen, um den Umgang mit Medien zu erlernen sowiemo<strong>der</strong>ne Medien zu nutzen, um das Lehren zu unterstützen. eSchool ist verantwortlich für rund 160 Schulen, einschließlichGrundschulen, weiterführenden Schulen, Berufskollegs und För<strong>der</strong>schulen sowie Weiterbildungskollegsmit insgesamt über 170 Standorten und mehr als 850 Gebäuden.AusgangslageDie Lernkultur an den Schulenverän<strong>der</strong>t sich. Die Nutzung digitalerMedien wird für Schülerinnen undSchüler zu einer Selbstverständlichkeitund Methoden zur Ermöglichungtechnisch fortschrittlichen undkollaborativen Lernens und Lehrensstehen auf <strong>der</strong> Agenda weit oben.Lernen mit digitalen Medien ist zu je<strong>der</strong>Zeit und überall möglich. Diese Tatsachesollte auch in <strong>der</strong> Schule angemessenberücksichtigt werden. Damit gewinnteine gut funktionierende IT-Infrastrukturzunehmend an Bedeutung.Die Landesregierung Nordrhein-Westfalenbegann das Projekt »Medien-Pass Nordrhein-Westfalen« imSchuljahr 2011/2012. In <strong>der</strong> erstenPhase des Projektes, bei <strong>der</strong> es um dieAusstattung <strong>der</strong> Schulen mit aktuellerInformationstechnologie ging, habensich zahlreiche Düsseldorfer SchulenFoto: Dominik Schmitz, LVR-ZMB28
01 | LERNEN MIT DIGITALEN MEDIENbeteiligt. Schnell zeigte sich, dass<strong>der</strong>en Ausstattung den Ambitionen imHinblick auf eine digitale Lernumgebungnicht zuträglich war. DesWeiteren war die Verbindung mit demInternet über Powerline (Verbindungüber 220 Volt Stromleitungen), wie siedie meisten Schulen nutzten, oftmalsinstabil und kostenintensiv. Gesuchtwurden effektivere Methoden, Lehrkräfteund Schulen dabei zu unterstützen,digitale Medien in den Schulenbesser nutzen zu können. Dabei wurdeauch untersucht, wie <strong>der</strong> drahtloseZugang sowie die Nutzung von Tabletshelfen könnten, die Ziele <strong>der</strong> Bildungsinitiativezu erreichen.Eine wichtige Aufgabe von eSchool istes, Lehrkräften dabei zu helfen, ihrenMedieneinsatz zu optimieren. InGesprächen mit den Schulen wurde dieAussicht auf ein hochperformantesWiFi-Netzwerk für den Zugang <strong>zum</strong>Internet und zu Lernmaterialien zuerhalten sofort positiv aufgenommen.Seien es nun Tablets o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>eGeräte wie TV, Laptop o<strong>der</strong> PCs, die imUnterricht <strong>zum</strong> Einsatz kommen – einhochleistungsfähiges und stabilesNetzwerk wurde als Basisbedingungfür den Erfolg jedweden Projektes mitdigitalen Medien angesehen. Abernicht nur das: Der Einsatz geeigneterFilter und die Kontrolle <strong>der</strong> Gerätewaren Grundvoraussetzungen für dieNutzung mobiler Geräte innerhalb <strong>der</strong>Bildungsumgebung.Die Bereitstellungsmethode variiertvon Schule zu Schule. Die rund 160Schulen entscheiden autonom, wie siedie neuen Technologien einsetzenwollen: Unterschiedliche Finanzierungsmodelle,Klassengrößen undSchülertypen verlangen dies. Entsprechendbenötigte eSchool eine WiFi-Lösung, die einfach zu erweitern undzentral zu verwalten ist. Notwendigwaren weiterhin die Kontrolle sowiedas Management des Zugangs überverschiedene Umgebungen hinwegsowie BYOD (»Bring your own device«)für die Geräte von Lehrkräften,Schülerinnen und Schülern o<strong>der</strong>Schulen.In enger Zusammenarbeit mit Applesuchte eSchool einen Netzwerkpartnerfür das kabellose Netz, das alsSchlüsselfaktor für die Mission, dasdigitale Lernen in den Schulen zurevolutionieren, dienen soll.LösungDie For<strong>der</strong>ung nach Flexibilität war einGrund dafür, dass die Wahl für dieDüsseldorfer Schulen auf Aerohive alsNetzwerkpartner fiel. Die Infrastruktursollte in <strong>der</strong> Lage sein, Lehrkräfte zuunterstützen, die ihre eigenen Gerätemitbringen, während an<strong>der</strong>e SchulenLehrkräfte, einzelne Schülerinnen undSchüler o<strong>der</strong> Gruppen mit Gerätenausstatten. Die Aufgabe ist es, ihnendies individuell zu ermöglichen undkeine zentralen Vorgaben zu machen.Entscheidet sich beispielsweise eineSchule dafür, iPads in ihrem Inhouse-Netz zu nutzen, dann ist die sichereIntegration dieser Geräte in Übereinstimmungmit den beschlossenenRichtlinien ein essenzieller Punkt.Dafür ist es notwendig, über einentsprechendes zentrales MobileDevice Management System (MDM)und über Sicherheits-Policies zuverfügen sowie über die notwendigeInternetkonnektivität.Die Access Points (APs) wurden in <strong>der</strong>ersten Phase des Projektes in 11Grundschulen und zwei weiterführendenSchulen installiert, die voneSchool mit 200 iPads für die Nutzungin Klassenräumen durch Lehrpersonenund Schülergruppen ausgestattetworden waren.Die gefundene Lösung ermöglichteSchool nicht nur die Bereitstellungeffizienter Netzwerke, son<strong>der</strong>n verfügtauch über die Funktionalität, diebenötigt wird, um Geräte in <strong>der</strong>Schulumgebung mittels Integrationeiner entsprechenden MDM-Software(<strong>zum</strong> Beispiel » JAMF«) zentral zuverwalten und zu kontrollieren. Esmuss sichergestellt sein, dass dieBildungseinrichtungen über einevollständige Lösung für WiFi-Installationenverfügen.ErgebnisDer von eSchool eingeschlagene Wegist in <strong>der</strong> praktischen Nutzung nochrecht neu. Die Ergebnisse in denSchulen, die bereits WiFi für denZugang und <strong>zum</strong> Management <strong>der</strong>smarten Geräte einsetzen, sind jedochdurchweg positiv.Die innovative »Düsseldorfer Lösung«hat bereits Wirkung gezeigt. Wird aufdiesem Weg weiter fortgeschritten,dann bildet sie eine intelligentedrahtlose Basis und ermöglicht denSchulen ebenso ihre eLearning-Initiativenweiter voranzubringen, dabeigleichermaßen die Bildungsumgebungkontinuierlich zu verbessern. ZumNachahmen empfohlenUwe Scholz M.A.Uwe Scholz ist Geschäftsführer vonUwe Scholz New TechnologyCommunication.29
MEDIENBRIEF | N° 02.2013EDMOND NRWmit iPadoffline nutzenSeit Umstellung des Videoformats auf MPEG-4 könnenalle EDMOND NRW-Medien im Streamingverfahren aufiPads genutzt werden. Bei zu geringer Bandbreite – o<strong>der</strong>wenn für das Abspielen keine Internetverbindung besteht– müssen sie jedoch heruntergeladen werden Diesfunktioniert bei iPads an<strong>der</strong>s als bei klassischen PCs.Voraussetzung: ein geeigneter Web-Browser für das iPad –Wir wollen eine App für die gesamte Nutzung – also<strong>Download</strong> und Wie<strong>der</strong>gabe – von allen EDMOND NRW-Medienverwenden. Die Medien müssen – sofern sie als Zip-Pakete vorliegen – entpackt werden. Beim lokalen Abspielenmüssen für die Navigation innerhalb einesMedienpakets alle <strong>Link</strong>s, die in den HTML-Seiten enthaltensind, funktionieren. Ein Browser, <strong>der</strong> diese Voraussetzungenerfüllt, ist iCab-Mobile und kann kostenpflichtig (<strong>der</strong>zeit 1,79Euro) im AppStore heruntergeladen werden.Herunterladen und Abspielen eines »Online-Films« (49erSignatur) o<strong>der</strong> Einzelclips aus Medienpaketen (55erSignatur) – »Online-Filme« liegen als Einzeldateien aufdem EDMOND NRW-Server und können direkt von dortheruntergeladen werden. Klickt man auf <strong>Download</strong>, wirdstattdessen auf dem iPad das Video wie<strong>der</strong>gegeben. Klicktman dann auf den laufenden Film und lässt den Finger eineWeile darauf, wird man gefragt, ob man den Film herunterladenmöchte. Wird dies bejaht, landet <strong>der</strong> Film im <strong>Download</strong>ordnervon iCab mobile, von wo er aus abgespieltwerden kann. Bei Einzelclips aus Medienpaketen funktioniertalles analog.Herunterladen, Entpacken und Abspielen eines Medienpakets– Aktiviert man in iCab einen <strong>Link</strong> auf einen Dateityp,<strong>der</strong> vom Browser nicht angezeigt werden kann, wird mangefragt, ob man die Datei herunterladen möchte. Genau daswollen wir. Das Zip-Paket landet also im <strong>Download</strong>-Ordner.Wenn Sie dort auf die Zip-Datei tippen, müssen Sie imaufspringenden Menü den Eintrag »Unzip« wählen. DieZIP-Datei wird entpackt und Sie erhalten einen Ordner mitgleichen Namen. Klicken Sie nun auf den Or<strong>der</strong>namen desentpackten Mediums und navigieren Sie zur Startseite desMediums. Es handelt sich dabei stets um eine HTML-Datei,die entwe<strong>der</strong> die Bezeichnung »Hauptmenü«, »Start« o<strong>der</strong>Ähnliches im Dateinamen hat. Diese Startdatei klicken Siean und wählen dann aus dem Aufklappmenü »Anzeigen«.Sie können nun das gesamte Medium »absurfen«.Herunterladen, Entpacken und Abspielen eines Medienpaketsvon einem Dateiserver – Um auf ein Zip-Paket aufeinem Fileserver zugreifen zu können, benötigen Sie eineApp, die uns das Protokoll des Servers zur Verfügung stellt.Grundsätzlich ist es egal, welche App Sie dafür verwenden,wichtig ist nur, dass diese App auf das Zip-Paket zugreifenund per »Öffnen mit« an iCab Mobile weitergeben kann.Wenn Sie das Zip-Paket in ihrer Netzwerk-App ausgewählthaben, leiten Sie es per »Öffnen mit...« an iCab Mobileweiter. Der Browser meldet sich damit, dass eine Datei anihn gesendet wurde, die nicht angezeigt werden könne unddass diese Datei in den <strong>Download</strong>-Bereich verschobenworden sei. Der Vorgang dauert allerdings eine Weile, dadas gesamte Paket vom Server auf das iPad geladenwerden muss. Öffnen Sie nun den <strong>Download</strong>-Ordner mitdem ZIP-Paket und fahren Sie fort, wie oben beschrieben.Standbild zur Weiterverarbeitung erzeugen – Das Erzeugeneines Standbildes aus einem Filmclip ist mit dem iPaddenkbar einfach. Sie müssen dazu nur den Aus-/Einschaltknopfund den »Home«-Button des iPads gleichzeitigdrücken. Der aktuelle Bildschirminhalt wird daraufhin alsBild unter Ihren Fotos gespeichert (das funktioniert sogarbei einem laufendem Film). Von dort können Sie es mitallen Anwendungen weiterverarbeiten, die auf die Bil<strong>der</strong>zugreifen können.Filmdatei zur Weiterverarbeitung speichern – Wenn Sieeine Filmdatei weiterverarbeiten wollen, ist es am sinnvollsten,wenn Sie diese zunächst bei ihren Bil<strong>der</strong>n imAlbum speichern, weil Sie dort mit allen in Frage kommendenApps (z.B. Keynote, iMovie usw.) darauf zugreifenkönnen. Tippen Sie hierzu in iCab-Mobile unter »<strong>Download</strong>s«auf die Videodatei und wählen dann »Video in Albumspeichern«.Wolfgang Dax-RomswinkelWolfgang Dax-Romswinkel ist Medienberater und Mitglied<strong>der</strong> Co-Leitung des Kompetenzteams Rhein-Sieg-Kreis.30
01 | LERNEN MIT DIGITALEN MEDIENEdOnein Beitrag <strong>zum</strong> Medienkonzept <strong>der</strong>Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL)Guter Unterricht braucht guteMedien»Unterricht gestalten und Lernprozessenachhaltig anlegen« ist eins <strong>der</strong>sechs zentralen Handlungsfel<strong>der</strong> desKerncurriculums zur Ausbildungangehen<strong>der</strong> Lehrerinnen und Lehrer.Dabei spielen digitale Medien einenicht unwesentliche Rolle. MitEDMOND NRW bieten die kommunalenMedienzentren qualitativ hochwertigeBildungsmedien, die in Verbindungmit den rechtlich eingeräumtenNutzungsmöglichkeiten erheblichePotenziale für eine Weiterentwicklungvon Unterricht bergen.Was ist EdOn?Mit EdOn erhalten angehendeLehrerinnen und Lehrer eine Einführungin den praktischen Umgang mitEDMOND NRW. Sie erfahren, wieBildungsmedien für den Einsatz imUnterricht adressatengerecht undzielorientiert recherchiert, heruntergeladenund abgespielt werden un<strong>der</strong>halten Einblick in Möglichkeiten <strong>der</strong>Be- und Verarbeitung zur För<strong>der</strong>ungaktiver Lernprozesse. Der Einsatz vonKommunikationsplattformen unddigitalen Tafeln rundet das praxisorientierteAngebot ab.EdOn ist ein Blended Learning-Kursmit Präsenzveranstaltungen undOnline-Phasen. Letztere werden mitHilfe einer internetbasierten Kommunikationsplattformorganisiert, wobeieine tutorielle Begleitung durch dieMedienzentrum vor Ort stattfindet. DerKurs ist in thematische Kursabschnitteunterglie<strong>der</strong>t. Themen aus <strong>der</strong>Präsenzveranstaltung werden auf <strong>der</strong>Online-Plattform vertieft und dasWissen anhand von konkretenAufgabenstellungen erprobt undangewendet.EdOn soll grundlegende Anwendungsfertigkeitenvermitteln. Zwar planendie Lehramtsanwärterinnen undLehramtsanwärter im Kurs einVorhaben für den eigenen Unterricht,in dem EDMOND-Medien genutztwerden, doch ist die didaktisch-methodischeReflexion und die konkreteDurchführung <strong>der</strong> Unterrichtssequenznicht mehr originärer Bestandteil.Idealerweise wird dies anschließend indie Seminararbeit integriert.EdOn eignet sich für alle Lehrämter.Da in den Ausbildungsschulen dieNutzung von EDMOND NRW oft schon<strong>zum</strong> Unterrichtsalltag gehört, ist essinnvoll, den Kurs möglichst zuBeginn <strong>der</strong> Ausbildung anzubieten.Lediglich allgemeine Grundkenntnisseim Umgang mit PC und Internetwerden vorausgesetzt.Barbara Bielefeld, Konstanze SigelBarbara Bielefeld und Konstanze Sigelsind Mitarbeiterinnen <strong>der</strong> MedienberatungNRW.Foto: LVR-ZMB31
MEDIENBRIEF | N° 02.2013Blumio macht Schule …YouTube verleiht jungem Rapper Kultstatus.Montag, 1. Juli 2013, 14.00 Uhr in einem Düsseldorfer Tonstudio. Ich habe einen Termin mit Blumio und seinem ProduzentenRusbeh. Zufällig bin ich auf den jungen Rapper aufmerksam geworden. Im Netz stieß ich auf das Musik-Video»Hey Mr. Nazi« und war von <strong>der</strong> Botschaft des Songs, aber auch von <strong>der</strong> sehr facettenreichen Sprache des jungenKünstlers spontan sehr angetan. Auch die Musik fiel mir positiv auf: Als »Japsensoul« bezeichnet Blumio seinemusikalische Stilrichtung und damit ist gemeint, dass es Elemente gibt, die sich von dem weit verbreiteten Bum-Bum-Rhythmus, den Rapper so sehr bevorzugen, deutlich abheben. Mein Interesse für die Person des jungen Künstlers wargeweckt. Mit ein paar Klicks stieß ich schnell auf weitere Produktionen, darunter auf den »Antigewaltsong«, »Rosenkrieg«und »Eberhard«. Großartig, dachte ich, hier mischen sich intelligente Lyrics mit toller Musik und ansprechendenVideos. Da passt alles zusammen. Damit kann man auch in <strong>der</strong> Schule etwas anfangen.Blumio findet den richtigen Ton. Ererreicht Jugendliche. Seine Konzertehaben großen Zulauf und MillionenYouTube-Klicks belegen sowohl dieBekanntheit als auch die Beliebtheitdes Künstlers. Inzwischen hat er dreiSoloalben aufgenommen und es lohntsich, diese mal in Ruhe anzuhören.Blumio betritt das Studio. Er ist sehrhöflich, gleichermaßen zurückhaltend.Das Klischee vom ungehobeltenRapper ohne Manieren bedient ernicht. Wir sprechen sofort über ihnund seine Musik. Inspiriert war erzunächst von <strong>der</strong> amerikanischenFoto: Bastian Saltzmann32
01 | LERNEN MIT DIGITALEN MEDIENGruppe Body Count und ihremFrontsänger Ice-T, dessen Image abereher in Richtung »Pimp« und »GangstaRap« ging, bis heute noch einwesentliches Stilelement des Rap.Anschließend kam die deutscheHip-Hop-Szene mit Bands wie»Freundeskreis« o<strong>der</strong> »AbsoluteBeginners«. Das war Blumios Musik.»Auf dieser Welle reite ich heutenoch«, so Blumio.Hey, Mr. NaziHey, Mr. Nazi komm auf meine Party.Ich stell dir meine Freunde vor.Das hier sind Juspé und Kati, Thorsten und Nefatih.Wir haben denselben Humor.Und wir sagen: Hey, Mr. Nazi komm’ auf meine Party –ich zeig dir meine Kultur.Das hier sind Sushi und Technik, Mangas und Origami,ich kenn das seit meiner Geburt.Blumio heißt mit bürgerlichem NamenFumio Kuniyoshi, ist in Hilden geborenund hat sich früh entschieden,Musiker zu werden. Ihm war schon mit16 klar, wie er sich seine Zukunftvorstellte. Die Idee, Künstler zuwerden, sagte ihm mehr zu alsirgendwo am Schreibtisch zu sitzeno<strong>der</strong> Lagerverkäufe zu organisieren.Diese Entscheidung kam schnell. Erhat den Schritt nie bereut, obwohl eslange dauerte, bis er von seiner Musikleben konnte.Es ist nicht leicht sich mit Einsamkeit herumzuschlagen,je<strong>der</strong> Mensch will doch Gleichgesinnte um sich haben.Und eh du dich versiehst bist du im Freundeskreis,indem man mit dem Finger auf an<strong>der</strong>shäutige Leute zeigt.Und das kann schnell gehen, das ist keine Lüge:Die meisten Menschen haben irgendwo rassistische Züge.Ich seh’ rassistische Lehrer und rassistischeHauptmänner und rassistische DeutscheUnd rassistische Auslän<strong>der</strong> ...(Textauszug aus dem Song »Hey, Mr. Nazi« von Blumio, zufinden auf dem »Yellow Album«, © Japsensoul 2011, sieheauch: www.youtube.com/watch?v=O-YaEEaGI80)Es sind die erwähnten Lyrics, die denjungen Mann zu einem beachtenswertenKünstler machen. Er versteht es,Alltagssituationen aufzugreifen, siesprachlich äußerst geschickt und raffiniert– niemals langweilig – umzusetzen.Seine Texte kommen sehrauthentisch rüber, sind sehr persönlichund geben einen Einblick in diekomplexe Gedankenwelt einesJugendlichen (auch wenn hiereigentlich schon ein Mann spricht),geprägt von einer dynamischenMischung aus Selbstwertgefühl undSelbstzweifeln. Es liegt Blumio sehrdaran, seine Texte auch mit einerBotschaft zu verknüpfen und genauhier hebt er sich zusätzlich vomgängigen Rap ab. Er will zeigen, dasser ein politischer Mensch ist undpositive Botschaften senden: Schlussmit Gewalt, Diskriminierung, mitVorurteilen, die zu Rassismus,Sexismus, Hass und Krieg führen. Erselbst hat sich oft als Außenseitergefühlt, Vorurteile am eigenen Leiberfahren – da war ein Schimpfwort wie»Schlitzauge« noch verhältnismäßigharmlos. Ich frage ihn, ob seinPublikum auf seine Texte achtet.»Absolut, sie verfolgen jede Zeile. Vielekönnen meine Texte auswendig.«In meiner Rolle als Lehrer ist esdieser – nennen wir es ganzheitliche– Ansatz, dem ich Beachtung gebenmöchte. Nicht nur Jugendliche könnenvon Blumio lernen. Bei YouTube undauf seiner Website erfährt man mehrüber ihn. Man kann ihn übrigens aucheinladen. Er hat bereits bei Schulfesten(»Schulkonzerte gegen Gewalt«)gespielt, und auch Rap-Workshopsgegeben. Des weiteren war er Gast inSchulklassen und hat in DiskussionsrundenThemen angesprochen, dieJugendliche interessieren. Er wirbt fürToleranz, macht Mut für Zivilcourageund erzählt, wie man seinen Traumleben kann. Aber auch davon, wieschwer das manchmal ist.Sind das nicht genug Argumente, demjungen Künstler Aufmerksamkeit zugeben und an passen<strong>der</strong> Stelle seineSongs in den Unterricht einzubinden?Karsten SchilliesKarsten Schillies ist Lehrer an <strong>der</strong>Hardenbergschule in Velbert undMedienberater im KompetenzteamDüsseldorf.33
MEDIENBRIEF | N° 02.201302 BerichteFotopreis für die besten Kin<strong>der</strong>fotos ... Tag <strong>der</strong> BegegnungFoto: Nicole Schäfer, LVR-ZMB34
Foto: Dominik Schmitz, LVR-ZMBFantasierenExperimentierenFotografierenAuf die Plätze-Foto-Los! Das Fotoportal»KameraKin<strong>der</strong>« startet denneuen Fotopreis für Kin<strong>der</strong> undKin<strong>der</strong>gruppen aus Nordrhein-Westfalen.Nach dem großen Erfolg desersten Kin<strong>der</strong>fotopreises NRW imletzten Jahr können 6-12-jährigeMädchen und Jungen wie<strong>der</strong> mitihren kreativsten, schönsten,beliebtesten, originellsten o<strong>der</strong>einfach nur lustigsten Aufnahmeneinen Preis gewinnen.Beim Wettbewerb mit freier Themenwahlsind <strong>der</strong> Fantasie keine Grenzengesetzt. Vielleicht haben die Kin<strong>der</strong>aber auch Lust, <strong>zum</strong> Son<strong>der</strong>thema»Experimentier mal!« zu fotografieren:aus ungewöhnlichen Blickwinkelnfotografieren, mit Licht und Bewegungexperimentieren, etwas genauuntersuchen o<strong>der</strong> Fotos am Computercollagieren – es gibt viele Möglichkeitenfotografisches Neuland zubetreten.Es winken attraktive Sach- undGeldpreise für die Fotos jungerEinzelkünstler, Kin<strong>der</strong>gruppen o<strong>der</strong>Schulklassen. Die Kin<strong>der</strong> erwarteteine fetzige Preisverleihung (14.Dezember, Altes Pfandhaus Köln),eine Ausstellung mit allen eingereichtenBil<strong>der</strong>n, ein »AbenteuerparcoursFotografie« und natürlich jede MengeSpaß und Ruhm.Einsendeschluss ist <strong>der</strong> 27. Oktober2013. Die Fotos lassen sich mit Hilfeeiner kindgerechten Anleitung aufwww.kamerakin<strong>der</strong>.de/nrw-wettbewerb.htmlhochladen o<strong>der</strong> können perPost an den Veranstalter, das jfcMedienzentrum, geschickt werden.Hintergrund: Als kindgerechtes Forumfür Fotografie stärkt »KameraKin<strong>der</strong>«die Auseinan<strong>der</strong>setzung mit demMedium und schafft einen unkompliziertenZugang zu aktiver Medienarbeitim Primarbereich, in <strong>der</strong> außerschulischenKin<strong>der</strong>arbeit und inFamilien. »KameraKin<strong>der</strong>« möchteKin<strong>der</strong> dazu animieren, die Möglichkeiten<strong>der</strong> Fotografie zu entdeckenund persönliche Aussagen über dieWelt zu treffen. Auf diesem Portalhaben Fotogruppen Gelegenheit, ihreWerke in einem sicheren Rahmen zupräsentieren. Pädagogen finden aufkamerakin<strong>der</strong>.de Projektvorstellungensowie didaktische Materialien.Sabine SonnenscheinSabine Sonnenschein ist Mitarbeiterinim jfc Medienzentrum, Köln(Fachbereich Medien).35
MEDIENBRIEF | N° 02.2013»Das ist ja <strong>der</strong> Hammer!«Die Foto-Mitmachaktion des LVR-ZMB am Tag <strong>der</strong> BegegnungUnbestritten ist <strong>der</strong> Tag <strong>der</strong> Begegnung<strong>der</strong> Höhepunkt im Veranstaltungskalen<strong>der</strong>des LandschaftsverbandsRheinland. Die vielen tausendGäste aus dem gesamten Rheinland,die ihn jedes Jahr besuchen, sprechenfür sich und am 29. Juni war eswie<strong>der</strong> nicht an<strong>der</strong>s.Anlässlich des 60jährigen Bestehensdes LVR wurde er dieses Jahr nicht inXanten, son<strong>der</strong>n im Rheinpark in Kölnveranstaltet. Der erste Eindruck wareinfach überwältigend! Vom Eingangam Tanzbrunnen einmal den gesamtenRheinpark bis ans an<strong>der</strong>e Ende an<strong>der</strong> Zoobrücke durchquerend, zeigtsich schnell die unglaubliche Vielfalt<strong>der</strong> Angebote, die sich den Besuche-rinnen und Besuchern an diesemJubiläumsfest darbietet – undmittendrin das LVR-Zentrum fürMedien und Bildung im gemeinsamenZelt <strong>der</strong> Kultureinrichtungen des LVR.Im vergangenen Jahr erfolgreich»getestet«, sind alle Besucherinnenund Besucher am ZMB-Stand wie<strong>der</strong>eingeladen, sich in einer improvisiertenFabrikkulisse als Schwerarbeiterfotografieren zu lassen. Mit Schweißerhelm,Handschuhen und Schutzbrilleausstaffiert, greifen alle entschlossenzu Vorschlaghammer,Schweißbrenner o<strong>der</strong> einem riesigenSchraubenschlüssel und werfen sichin Pose. Alle schlüpfen ohne zu zögernin diese Rolle und den ganzen Tagüber herrscht eine schon ansteckendeSpielfreude. Und was ist <strong>der</strong> eigentlicheReiz? Alle bekommen sofort einFoto ausgedruckt und können esfreudestrahlend als Erinnerung mitnach Hause nehmen!Übrigens: Vom 4. November bis <strong>zum</strong>17. Dezember 2013 wird eine Auswahl<strong>der</strong> schönsten Bil<strong>der</strong> in einer kleinenAuswahl im Horion-Haus des LVR inKöln-Deutz zu sehen sein…Michael JakobsMichael Jakobs ist Referent fürÖffentlichkeitsarbeit im LVR-ZMB.Foto: LVR-ZMB36
03 Partnerim VerbundSchulentwicklung in NRW ... Gemeinsames Lernen...Inklusive SchulKinoWochen ... Moodle-Treff <strong>der</strong>Bezirksregierung Düsseldorf ... Grimme Online Award ...Neues aus dem LWL-Medienzentrum für Westfalen ...Foto: Julia Reschucha, LVR-ZMB37
MEDIENBRIEF | N° 02.2013Länger gemeinsam lernenSchulentwicklung in NRWImmer mehr Eltern und Schulträger entscheiden sich fürSchulformen des längeren gemeinsamen Lernens. Ebensowie die Gesamtschule hält auch die SekundarschuleBildungswege länger offen und ermöglicht den Kommunen,bei zurückgehenden Schülerzahlen ein umfassendes,weiterführendes Schulangebot mit gymnasialen Standardsvor Ort zu erhalten.Mit Beginn des Schuljahres 2012/2013 sind erstmals 42neue Sekundarschulen und 20 neue Gesamtschulengestartet. Zum neuen Schuljahr 2013/14 werden weitere 39neue Sekundarschulen und 29 neue Gesamtschulen folgen.Merkmale des längeren gemeinsamen Lernens an Sekundar-,Gesamt- und Gemeinschaftsschulen auf. SechsThemenfilme ergänzen den Einführungsfilm und vertiefeneinige <strong>der</strong> dort angeschnittenen Fragestellungen.Die DVD kann beim Schulministerium NRW bestellt werden.Alle Filme sowie das Booklet zur DVD stehen auch als<strong>Download</strong> zur Verfügung: www.schulministerium.nrw.de/BP/Publikationen/Filme/LaengerLernen/index.htmlFriedhelm JennessenDie DVD, produziert vom LVR-Zentrum für Medien undBildung, gibt Lehrkräften Hilfestellungen und Anregungenfür die Schulpraxis und zeigt beispielhaft die beson<strong>der</strong>enFriedhelm Jennessen ist Referent im Ministerium fürSchule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen.Foto: Dominik Schmitz, LVR-ZMBB38
03 | PARTNER IM VERBUND»Auf dem Weg zurinklusiven Schule«Einblicke in die Praxis des Gemeinsamen LernensSeit den Beschlüssen <strong>der</strong> nordrhein-westfälischenLandesregierung zur Umsetzung <strong>der</strong> UN-Behin<strong>der</strong>tenrechtskonventionsteht das Thema Inklusion in <strong>der</strong> Schuleganz oben auf <strong>der</strong> schulpolitischen Agenda. Eine breiteÖffentlichkeit diskutiert engagiert über Bedingungen <strong>zum</strong>Gelingen des Gemeinsamen Lernens von Schülerinnenund Schülern mit und ohne Behin<strong>der</strong>ungen in allgemeinenSchulen. Gleichzeitig löst dieses Thema bei den amSchulleben Beteiligten unterschiedliche Reaktionen undAssoziationen aus; es ist mit Wünschen, aber auch mitSorgen verknüpft.Kin<strong>der</strong> und Jugendliche mit und ohne son<strong>der</strong>pädagogischemFör<strong>der</strong>bedarf, die in einem Klassenzimmer gemeinsamlernen – wie kann das konkret aussehen? Häufig fälltes Menschen, die bisher wenige Berührungspunkte mitdem Gemeinsamen Unterricht haben, schwer, sich solcheLernsituationen als erfolgreich vorzustellen.Das Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW hatdaher im Dezember 2011 beim LVR-Zentrum für Medienund Bildung die Produktion einer DVD in Auftrag gegebenmit dem Ziel, anhand von Bil<strong>der</strong>n aus Schulen des GemeinsamenLernens Anregungen zu geben und zu ermutigen,sich auf den Weg des inklusiven Lernens zu begeben.Entstanden sind neun Filmsequenzen, die das GemeinsameLernen aus vielfältigen Perspektiven beleuchten undverschiedene Fragestellungen aufgreifen. Im 20-minütigenEinführungsfilm sowie acht kurzen Themenfilmen werdensowohl Grundschulen als auch Schulen <strong>der</strong> Sekundarstufegezeigt, die <strong>zum</strong> Teil auf eine jahrelange Praxis desGemeinsamen Lernens zurückblicken können, <strong>zum</strong> Teilaber auch gerade erst begonnen haben. Bewusst wurdenSchulen mit unterschiedlichen konzeptionellen Ansätzenausgewählt, um ein breites Spektrum an Beispielen ausdem schulischen Alltag zu zeigen. So geht es um dieGestaltung von Unterricht und Schulleben ebenso wie umKooperationsformen o<strong>der</strong> auch einen biografischen Blickauf 20 Jahre Gemeinsamer Unterricht. Schulleitungen undLehrkräfte kommen dabei ebenso zu Wort wie Schülerinnenund Schüler und <strong>der</strong>en Eltern.Die Filme erzählen davon, wie Schritte zur Inklusion imSchulalltag konkret gestaltet werden können. Und siezeigen auch, wie alle Beteiligten gemeinsam Wege finden,um Herausfor<strong>der</strong>ungen zu meistern sowie Vielfalt alsChance zu erfahren und zu nutzen. Kritischen Gedankengeben sie dabei Raum und lassen es zu, dass mancheFrage unbeantwortet bleibt. Inklusion ist ein Prozess.An wen wendet sich die Produktion? Neben allen an Schulebeteiligte Akteuren, möchte sie insbeson<strong>der</strong>e auch Elternund eine interessierte Öffentlichkeit ansprechen. Daherstehen die Filmsequenzen auch als <strong>Download</strong> im Bildungsportalzur Verfügung unter: www.schulministerium.nrw.de/BP/Publikationen/Filme/InklusiveSchule/index.htmlDarüber hinaus sind ein Begleitheft mit Inhaltsangaben zuden Filmsequenzen sowie weiterführenden Texten <strong>zum</strong><strong>Download</strong> bereitgestellt. Alle Filme können wahlweise mitGebärdensprache und mit Audiodeskription (Hörfilm)abgespielt werden.Thomas WienersThomas Wieners ist Mitglied <strong>der</strong> Projektgruppe Inklusionbeim Ministerium für Schule und Weiterbildung desLandes Nordrhein-Westfalen.39
MEDIENBRIEF | N° 02.2013Inklusive SchulKinoWochen NRW 2013Eine filmische ProjektdokumentationDie DVD vermittelt einen anschaulichen Eindruck überinklusive Filmbildung in <strong>der</strong> Praxis. Sie dokumentiert denAblauf eines Projekttages im Kino sweetSixteen in Dortmundwährend <strong>der</strong> SchulKinoWochen NRW 2013. Schülerinnenund Schüler aus För<strong>der</strong>schulen und Regelschulensahen zunächst den Film »Vorstadtkrokodile« und setztensich anschließend in gemischten Workshops damit auseinan<strong>der</strong>,betreut von Studierenden <strong>der</strong> TU Dortmund. DieGrundlage <strong>der</strong> Workshops bildete das von FILM+SCHULENRW erstmalig für heterogene Lerngruppen herausgegebeneBegleitmaterial <strong>zum</strong> Film »Vorstadtkrokodile«. (Kostenloser<strong>Download</strong> unter www.filmundschule.nrw/Inklusion)Der Projekttag war das Kernstück eines Pilotprojekts vonFILM+SCHULE NRW und des Lehrstuhls für motorischeEntwicklung und frühe Hilfen <strong>der</strong> Technischen UniversitätDortmund mit <strong>der</strong> Fragestellung: Können inklusive Filmvorführungenim Rahmen <strong>der</strong> SchulKinoWochen einen Beitragzur Bewusstseinsbildung beim Thema Behin<strong>der</strong>ung leisten?Ob tatsächlich eine Einstellungsverän<strong>der</strong>ung durchgemeinsame Filmerlebnisse erreicht werden kann, wurdebegleitend zu diesem Projekttag von Dr. Ingo Bosse, TUDortmund, wissenschaftlich untersucht. Der Forschungsberichtsteht ab September 2013 auf <strong>der</strong> Homepage vonFILM+SCHULE NRW www.filmundschule.nrw.de <strong>zum</strong>kostenlosen <strong>Download</strong> zur Verfügung. Die DVD »InklusiveSchulKinoWochen NRW 2013 – eine filmische Projektdokumentation«wurde von FILM+SCHULE NRW mit freundlicherUnterstützung <strong>der</strong> Firma Hörmann produziert und kannkostenlos bezogen werden im LW-Medienzentrum fürWestfalen. Kontakt: Cornelia Laumann, Tel: 0251.591-5618,Email: Cornelia.Laumann@lwl.orgAnnika NeumannAnnika Neumann ist Wissenschaftliche Volontärin imLWL-Medienzentrum für Westfalen.SchulKinoWochen NRW16.1. bis 5.2.2014Mit 82.279 Besuchern waren die SchulKinoWochen NRW2013 ein voller Erfolg. Wir freuen uns schon jetzt auf IhrenBesuch im nächsten Jahr! Wenn Sie über den Start <strong>der</strong>SchulKinoWochen NRW 2014 informiert werden möchten,können Sie uns auf unserer Homepage www.schulkinowochen.nrw.deihre Emailadresse mitteilen. Wir informierenSie rechtzeitig über das Programm und die Anmeldung.40
03 | PARTNER IM VERBUND»fit4web«Moodle-Kurs <strong>der</strong> Bezirksregierung Düsseldorf»fit4web«?! - lautet <strong>der</strong> Name desneuen Online-Kurses zur Medienerziehungfür Grund- und jungeSekundarstufenschüler, den <strong>der</strong>Moodle-Treff <strong>der</strong> BezirksregierungDüsseldorf allen Schulen kostenlos<strong>zum</strong> <strong>Download</strong> anbietet. Der Namedes Kurses ist Programm, fasst erdoch die zentrale Fragestellung alleran Medienerziehung beteiligterAkteure zusammen: Wie könnenjunge Menschen umfassendeKompetenzen erwerben, um dieChancen und Gefahren des Internetszu erkennen und angemessen daraufzu reagieren?Foto: Nicole Schäfer, LVR-ZMBDie Problematik ist nicht neu.Öffentliche und private Organisationenhaben <strong>zum</strong> Teil sehr umfangreicheund qualitativ hochwertigeMaterialsammlungen in Form vonKopiervorlagen erstellt, die kostenlosbenutzt werden können. Auch werdenmo<strong>der</strong>ierte Foren, internetbasierteLernprogramme, Spiele o<strong>der</strong>jugendgerechte Videos zur Problematikangeboten. An einer reichenAuswahl an Materialien fehlt es nicht.Dennoch wird an vielen Schulen dieMedienerziehung überwiegendunsystematisch betrieben undfokussiert immer noch auf dieBedienungskompetenz für Standardprogramme,wie <strong>zum</strong> Beispiel Text-,Tabellen- und Bildverarbeitung. Denneuen Herausfor<strong>der</strong>ungen haben sichdie Kollegien in vielen Fällen nochnicht gestellt.41
MEDIENBRIEF | N° 02.2013Schon heute gehört es bei Sechst- und Siebtklässlern <strong>zum</strong>guten Ton, einen eigenen Facebook-Account (Nutzung ab 13Jahre) zu besitzen. Nicht selten haben die Eltern denZugang selber eingerichtet, um ihre Sprößlinge kontrolliertin die sozialen Netzwerke einzuführen. Der Druck auf dieMitschüler, <strong>der</strong>en Eltern dieses nicht wünschen o<strong>der</strong> diesozialen Netzwerke nicht benutzen, steigt. So ist es nichtverwun<strong>der</strong>lich, dass spätestens in <strong>der</strong> siebten Klasse mehrals 60 Prozent aller Schüler regelmäßig über ein sozialesNetzwerk kommunizieren. Darüber hinaus ist <strong>der</strong> sichereUmgang mit Facebook und Co nicht gleichzusetzen miteiner umfassenden Medienkompetenz. Mehr denn je mussden Schülern gezeigt werden, wie Computer, Tablet undSmartphone als Lernwerkzeuge große Vorteile bringenkönnen.Das Online-Angebot »fit4web« möchte Lehrkräften denEinstieg in die umfangreiche Thematik erleichtern.Hinsichtlich des Umfangs und <strong>der</strong> Komplexität <strong>der</strong> Themenschwerpunkteeignet sich Fit4Web auch für medienpädagogischeEinsteiger. Eine Fokussierung auf wenigeinhaltliche Schwerpunkte mit einem begrenzter Materialpoolsoll die Orientierung verbessern. Die übersichtliche,modulare Kursstruktur des Online-Kurses erlaubt es,Themenbereiche unabhängig voneinan<strong>der</strong> zu bearbeiten.Anpassungen durch Ein-, Ausblenden sowie Än<strong>der</strong>ungenbezüglich <strong>der</strong> Aufgabenstellungen sind leicht möglich undgeben ein hohes Maß an Flexibilität für die eigene Lerngruppe.Für die Grundschule wird es mehrere Kursräumemit Schwerpunkten auf unterschiedlichen Kompetenzbereichengeben.»Fit für das Web« wird man aber nicht durch das Ausfüllenvon Arbeitsblättern. Das eigene Erleben, die eigenverantwortlicheBedienung des Werkzeugs Computer eignet sichbeson<strong>der</strong>s gut für einen authentischen Medienkompetenzerwerb.Mit dem Einsatz <strong>der</strong> Lernplattform Moodle schafftman die nötige Orientierung im weltweiten Web als Ausgangspunktfür das eigene Handeln. Der Online-Kurs»fit4web« ist speziell für die Moodle-Lernplattform gemachtund nutzt im beson<strong>der</strong>en Maße die Vielzahl <strong>der</strong> interaktiven,kommunikativen und kooperativen Lernaktivitäten (wie z.B.Wiki, Blog, Forum, Chat...), die eine abwechslungsreicheHerangehensweise erlauben. Ferner fungiert die Lernplattformauch als Schutzraum, bei dem reale Funktionalitätenunter Ausschluss <strong>der</strong> Weltöffentlichkeit eingeübt werdenkönnen.Mit dem Online-Kurs »Fit4Web« kann <strong>der</strong> Einstieg in einenwichtigen Teil <strong>der</strong> Medienerziehung gelingen. Es kommt bei<strong>der</strong> Medienerziehung nicht darauf an, zu lernen wie welcheProgramme bedient und benutzt werden können, son<strong>der</strong>ndie Schüler bei einer kritischen Auseinan<strong>der</strong>setzung mitden Möglichkeiten <strong>der</strong> digitalen Welt zu begleiten. Aber erstdie Berücksichtigung im Medienkonzept <strong>der</strong> Schule unddamit eine »obligatorische« Durchführung in den jeweiligenJahrgangsstufen wird zu den erwünschten Kompetenzenbei den Schülerinnen und Schülern führen. Neben denorganisatorischen, pädagogischen und technische Rahmenbedingungenmüssen die Kompetenzen <strong>der</strong> Lehrkräfteberücksichtigt werden. Wenn Sie neugierig geworden sind,gehen Sie auf die Seite www.moodletreff.de und geben Sieunter »Kurse suchen« den Begriff »Fit4Web« ein.Viel Spass beim Stöbern!Marc Lachmann und Rainer DoeringMarc Lachmann ist Lehrer am Gymnasium in den Fil<strong>der</strong>Benden in Moers.Rainer Doering ist Lehrer am Max-Planck-Gymnasium inDuisburg.42
03 | PARTNER IM VERBUNDGütesiegel für die ZukunftDer Grimme Online Award»Auf keinen Fall sollte er lediglich <strong>der</strong>kleine Bru<strong>der</strong> des renommierten AdolfGrimme Preises werden. Damit er sicheigenständig entwickeln konnte,musste er sich eindeutig vom Fernsehpreisunterscheiden. Deshalbwählten wir bewusst den englischenTitel Grimme Online Award «, soFriedrich Hagedorn, <strong>der</strong> den Preiskonzipiert hat und bis heute amGrimme-Institut für ihn und dessenEntwicklung verantwortlich ist.Entstanden ist <strong>der</strong> Preis Ende <strong>der</strong>1990er Jahren, als die Fernsehsen<strong>der</strong>die Möglichkeiten des Netzes für sichentdeckten und begannen, Programmbegleitende und qualitativ hochwertigeInternetseiten ins Netz zu stellen.Dieser Entwicklung konnte und wolltesich das Grimme-Institut einerseitsnicht verschließen, an<strong>der</strong>erseits wares schwer, solche Angebote alsSon<strong>der</strong>preis in den Fernsehpreis zuintegrieren.Friedrich Hagedorn ist seit Ende <strong>der</strong> 80er Jahre imGrimme-Institut tätig. Seit 1995 betreut er das ReferatMedienbildung, entwickelte und verantwortet denGrimme Online Award. Fachliche Schwerpunkte sind:(Weiter-) Bildung und Online-Kommunikation, Vermittlungvon Medienkompetenz, neue Formen <strong>der</strong> medialenWissensvermittlung und Nachhaltigkeitskommunikation.Professionelle im Focus, son<strong>der</strong>n auch Kombination von Expertenwissenneue und alternative, z. T. schräge und Nutzerkompetenz«, so Hagedorn.Web-Angebote: »Nur durch kleineNachwuchsprojekte, die Graswurzelgewächsedes Netzes und quergewebtenAngebote, kann eine Heterogenität Interesse bei Politikern und in Medi-Seit Anbeginn hat <strong>der</strong> Preis großesgarantiert werden«, so Hagedorn. en erfahren. Das Land Nordrhein-Daneben wird ein eigener Publikumspreisverliehen, bei dem alle Nutzerin-Online Award. Dr. Angelica Schwall-Westfalen för<strong>der</strong>t den Grimmenen und Nutzer selbst unter den Düren, Ministerin für Bundesangelegenheiten,hob in ihrem Grußwortnominierten Vorschlägen ihre Favoritenauswählen können, eine »gewollte bei <strong>der</strong> Preisvergabe 2013 die hoheDie Trophäe <strong>zum</strong> Grimme Online Award 2013, Foto: Grimme Online AwardSo entstand <strong>der</strong> eigenständige OnlineAward, <strong>der</strong> zwar zu Beginn starkRundfunk orientierte Angeboteprämierte, schnell aber das gesamteNetz in den Blick nahm und – beianfänglich rund 300 Einreichungen –2001 <strong>zum</strong> ersten Mal in Köln verliehenwurde.Bis heute ist <strong>der</strong> Preis in bestimmteKategorien unterteilt. Die Nominierungskommissionund Jury sindkompetent besetzt und ringen injedem Jahr um jede Entscheidung.Hierbei ist nicht nur das Gängige,43
MEDIENBRIEF | N° 02.2013www.nrw-museum.de: Plattform <strong>der</strong> Kunst und <strong>der</strong> Museen in Nordrhein-Westfalen – Foto: Screenshot des Web-AuftrittsAnerkennung des Preises hervor: »Mitdem Grimme Online Award leistet dasGrimme-Institut einen Beitrag zu einergesellschaftlichen Debatte, die in <strong>der</strong>digitalen Gesellschaft immer wichtigerwird.« Das große Engagementzahlreicher Partner über die Jahrehinweg zeigt ebenfalls die Attraktivitätdes Preises über ein reines Medienfachpublikumhinweg.Interessant ist, dass <strong>der</strong> Preis in denersten Jahren durch – vom damaligenHauptsponsor Intel finanzierte – prominentePaten wie den verstorbenenHollywoodstar Dennis Hopper o<strong>der</strong>Gerhard Depardieu von Beginn ansogar in Zeitschriften wie »Gala« o<strong>der</strong>»Bunte« wahrgenommen wurde.»Diese Riesenspanne zwischenPopularität und seriöser Prämierungwar nicht immer ganz einfach«, sagtFriedrich Hagedorn. Doch das Konzeptging auf: Nach fünf Jahren hatte sich<strong>der</strong> Preis als Marke etablieren können– mit einer vergleichbaren Akzeptanz,Seriosität und Glaubwürdigkeit wie <strong>der</strong>Grimme-Fernsehpreis. Heute istbereits die Nominierung <strong>zum</strong> Preis fürdie kleinen, neuen Netzanbieterwertvolles Sprungbrett, <strong>der</strong> Preisselbst ein Gütesiegel für die Zukunft.»Die Sprache und die Verbindungzwischen analoger und digitaler Weltstanden in diesem Jahr im Fokus <strong>der</strong>Angebote, die die Jury des GrimmeOnline Award ausgezeichnet hat«,heißt es im Statement <strong>der</strong> diesjährigenJury. Entsprechend wurden Nominierteausgezeichnet, die beson<strong>der</strong>skreativ und einfallsreich mit <strong>der</strong>Preisvergabe Grimme Online Award 2013> Kategorie Informationwww.<strong>der</strong>-postillion.com (satirische Tageszeitung)> Kategorie Informationwww.politnetz.ch (Plattform für Schweizer Politik)> Kategorie Wissen und Bildungwww.alma.arte.tv./de (Webdokumentation)> Kategorie Wissen und Bildungwww.soziopod.de (»Sozio-Podcast«)> Kategorie Wissen und Bildungwww.dw/planb (Multimedia-Special <strong>der</strong> Deutschen Welle)> Kategorie Kultur und Unterhaltungwww.11freunde.de/liveticker (Fußball-Begleitung)Sprache gearbeitet haben: »Das Webist ein relevanter, notweniger Kulturraum,<strong>der</strong> <strong>der</strong> Sprache neue Möglichkeiten<strong>der</strong> Entfaltung und Wirksamkeiteröffnet.« Nachdem 2005 mit»bildblog.de« und 2001 das ersteTwitter-Format einen Preis erhielt,wurde beim <strong>aktuellen</strong> Preis erstmalsein »Hashtag« prämiert.Dr. Michael Troesser> Kategorie Kultur und Unterhaltungwww.nrw-museum.de (Museumsplattform für 20 Museen in NRW)> Kategorie Spezialwww.twitter.com/#aufschrei (Bündelung von Seiten <strong>zum</strong> Thema Sexismus)44
03 | PARTNER IM VERBUNDWestfalen geben immer Vollgas!Werbeinitiative mit selbstironischen PostkartenDas LWL-Medienzentrum für Westfalenhat in Kooperation mit <strong>der</strong>Westfalen-Initiative fünf verschiedeneWestfalen-Postkarten veröffentlicht.Die Vor<strong>der</strong>seiten zeigen historischePorträtaufnahmen echter Westfalen-Typen in Kombination mit verschiedenenamüsanten »Westfalen-Sprüchen«.Die Karten liegen ab sofort anvielen Stellen in Westfalen-Lippe zurkostenlosen Mitnahme aus.liegen dort zur kostenlosen Mitnahmeaus. Natürlich erhalten Sie die Kartenauch im LWL-Medienzentrum.Die historischen Motive stammen ausdem Bildarchiv des LWL-Medienzentrums.Drei <strong>der</strong> insgesamt fünfFotografien gehören zur SammlungIgnaz Böckenhoff. Der überaustalentierte Amateurfotograf hatte seitBeginn <strong>der</strong> 30er- bis hinein in die70er-Jahre alles und jeden in seinerHeimatgemeinde Raesfeld vor dieLinse gebracht. Beson<strong>der</strong>s eindrucksvollsind die vielen liebevollenPersonenaufnahmen. Kreative Köpfeim LWL-Medienzentrum für Westfalenund bei <strong>der</strong> Westfalen-Initiativesteuerten die jeweiligen Sprüche zuden Motiven bei.»Westfalen geben immer Vollgas!«,»Westfalen blicken durch!« o<strong>der</strong>»Westfalen lassen sich nicht hängen!«– solchen Aussagen stimmtje<strong>der</strong> gebürtige und Wahlwestfalegerne zu! Gerade weil die Sprüche aufden Karten mit dem verbreitetenKlischee des sturen, introvertiertenund humorlosen östlichen Nachbarn<strong>der</strong> Rheinlän<strong>der</strong> auf ironische Art undWeise spielen. Die Motive versprühenLebenslust und ein gesundesSelbstbewusstsein. Das mit <strong>der</strong>Region Westfalen – dem eigenenLebensraum – verbinden zu können,stärkt die eigene Westfalen-Identitätund macht einfach Spaß.Wer nun Verwandten, <strong>der</strong> altenFreundin o<strong>der</strong> auch dem netten Kollegenim an<strong>der</strong>en Landesteil Nordrhein-Westfalensmit einem Kartengrußeine Freude machen möchte,findet die Postkarten bei allenteilnehmenden Sparkassen, Jugendherbergen,Provinzial-Geschäftsstellenund LWL-Museen sowie –Kultureinrichtungenin Westfalen-Lippe. Sie45
MEDIENBRIEF | N° 02.2013MEDIENBRIEF | N° 02.2013FotoPostkarten:© LWL-Medienzentrum für WestfalenHintergrundDas Bildarchiv im LWL-Medienzentrumfür Westfalen besteht bereits seit1986. Es sammelt und sichert historischeBildbestände zur Kulturgeschichteund Landeskunde Westfalens.Die Fotos stammen aus privatemo<strong>der</strong> öffentlichem Besitz. Das Bildarchivbeauftragt aber auch aktuelle Fotodokumentationenüber Land undLeute von heute für die Westfalen vonmorgen. Die Bestände werdenkontinuierlich erschlossen und imOnline-Bildarchiv zugänglich gemacht.Bereits jetzt sind dort über 50.000Fotos verfügbar.Ebenfalls neu: Das Bildarchiv bietetseit kurzem eine Reihe digitalerLernmodule unter dem Titel »WieFotos Geschichte erzählen« an. Mitdiesen kann man jeweils ein historischesFoto aus dem Bildarchiv – imwahrsten Sinne des Wortes – unter dieLupe nehmen. Jedes Modul behandeltein Foto inklusive Einführung, Arbeitsaufträgen,Hintergrundinformationensowie Vertiefungsaufgaben. Mit einemZusatz-Modul kann sogar jedesbeliebige JPG-Bild in die Programmoberflächegeladen und im Unterrichtbearbeitet werden. KompetenzorientierterUnterricht trifftentdeckendes Lernen am Computer!<strong>Link</strong> <strong>zum</strong> Online-Bildarchiv desLWL-Medienzentrums für Westfalen:www.bildarchiv-westfalen.lwl.orgMareen KappisMareen Kappis ist wissenschaftlicheVolontärin im LWL-Medienzentrum fürWestfalen.46
04 | VERANSTALTUNGEN04 VeranstaltungenKin<strong>der</strong>KinoFest Düsseldorf ...5. Bildungspartner-KongressFoto: Dominik Schmitz, LVR-ZMB47
MEDIENBRIEF | N° 02.2013Kin<strong>der</strong>KinoFest Düsseldorfvom 14.-20. November 2013In diesem Jahr präsentiert sich das KiKiFe unter dem Motto »725 Jahre Düsseldorf – das Kin<strong>der</strong>KinoFest gratuliert«.Mit einem bunten Strauß aus tollen Kin<strong>der</strong>- und Jugendfilmen sowie Mitmachaktionen gibt es an jedem Tag <strong>der</strong>KiKiFe-Woche immer einen Grund zu Feiern. In vielen Stadtteilen veranstalten Düsseldorfer Kin<strong>der</strong>- und Jugendeinrichtungenkreative und witzige Veranstaltungen parallel <strong>zum</strong> Filmprogramm des 28. Kin<strong>der</strong>KinoFestes Düsseldorf.Vom 14. bis <strong>zum</strong> 20. November 2013können Kin<strong>der</strong> und Jugendliche von 4bis 16 Jahren Zeitreisen ins Mittelalter,Liebesgeschichten, Abenteuerund Fantastisches in den DüsseldorferKinos erleben. Erwachsene dürfenselbstverständlich mitgebrachtwerden.Düsseldorf feiert seinen 725. Geburtstagauch mit seinen Partnerstädten inaller Welt und so zeigen wir mit»Mongolian Ping Pong« und »Sommerin Haifa« Filmschätze aus China undIsrael, die es selten zu sehen gibt. Diejahrelange gute Zusammenarbeit mitden Kin<strong>der</strong>- und Jugendeinrichtungendieser Stadt feiern wir mit einem »HistorischenKino-Samstag« – einaktionsreiches Programm rund umdas Thema Filmgeschichte undMittelalter im Filmmuseum..Ein beson<strong>der</strong>s kindgerechtes Programmerwartet die Vorschulkin<strong>der</strong> ab4 Jahren, so dass <strong>der</strong> erste Kinobesuchmit <strong>der</strong> Kita-Gruppe noch langeFoto: Benedikt Klemm, LVR-ZMB48
03 | VeranstaltungenEröffnungsfilm:SchatzritterD/LUX 2011, 101 Min., FSK: 6Empfohlen ab 9Foto: farbfilm VerleihDer elfjährige Jeff wohnt mit seinem Vater auf einem Campingplatz in <strong>der</strong> Nähe einer alten Burgruine, die seinerFamilie gehört. Jeffs Mutter war vor einigen Jahren zu Hause auf unerklärliche Weise ums Leben gekommen. In denSommerferien machen sich Jeff und seine Freunde Leo, Jean-Bapiste und Julia auf die Suche nach dem verborgenenSchatz <strong>der</strong> schönen Meerjungfrau Melusina. Dabei entdeckt Jeff Hinweise auf seine verstorbene Mutter. Auf <strong>der</strong> Jagdnach dem Schatz müssen die vier Schatzritter auf <strong>der</strong> Burg, in Museen, in Schlössern und unterirdischen Flüssen somanches Abenteuer bestehen, während ihnen <strong>der</strong> unheimliche „schwarze Bru<strong>der</strong>“ Duc de Berry auf den Fersen ist.in guter Erinnerung bleibt. So lerntdas »Grüffolokind« seine Ängste undKräfte kennen, als es heimlichaußerhalb <strong>der</strong> wohnlichen Höhle denwinterlichen Wald erkundet.Eine wun<strong>der</strong>bare Kurzfilmreiheüberrascht die kleinen Filmfans mitkreativen, ungewöhnlichen undpreisgekrönten neuen Kurzfilmen.Aus <strong>der</strong> Sicht eines autistischenJungen, findet das große ThemaInklusion in dem Kin<strong>der</strong>film »DasPferd auf dem Balkon« einen sehrkindgerechten und dazu noch unterhaltsamenund anrührenden Weg indie Herzen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>. Dieser Preisträger-Filmwird vom größten deutschenKin<strong>der</strong>medienfestival »GoldeneSpatz« präsentiert, <strong>der</strong> mit Glück aucheinen Filmgast mit nach Düsseldorfbringt.Natürlich sind in diesem Jahr auchwie<strong>der</strong> spannende Filme für Teenagerab 12 und für Jugendliche ab 16Jahren im Programm.Ein kleines, feines Filmprogramm fürjunge Leute von 12-27 haben diefilmbegeisterten Teams <strong>der</strong> JugendeinrichtungenzeTT und Puls imProgrammteil »Abgedreht« zusammengestellt.Amina JohannsenAmina Johannsen ist WissenschaftlicheReferentin und stellvertretendeLeiterin <strong>der</strong> Abteilung Medienbildungim LVR-ZMB.49
MEDIENBRIEF | N° 02.2013»Vielfalt. Nutzen.«5. Bildungspartner-KongressAm 27.11.2013 begrüßt die Medienberatung NRW erneutzahlreiche Bildungsakteure im Kongresszentrum <strong>der</strong>Dortmun<strong>der</strong> Westfalenhallen. Im Fokus des diesjährigenBildungspartnerkongresses stehen heterogene Lerngruppenund Schulkooperationen.Seit 2005 veranstaltet die Medienberatung NRW imzweijährigen Turnus den »Bildungspartnerkongress«, einZusammentreffen von Bildungsakteuren aus dem Bereich<strong>der</strong> Schulkooperationen mit außerschulischen Partnern inden Kommunen. In diesem Jahr geht <strong>der</strong> Kongress unterdem Titel »Vielfalt. Nutzen.« in die fünfte Runde. Nebenneuen inhaltlichen Impulsen, etwa zur För<strong>der</strong>ung vonLese- und Lernkompetenzen, präsentiert er erfolgreicheModelle systematischer Zusammenarbeit von Schulen mitihren außerschulischen Partnern. Der inhaltliche Schwerpunktliegt dabei auf den vielfältigen Möglichkeiten, diesich aus diesen Kooperationen für die Arbeit mit heterogenenLerngruppen ergeben. Zahlreiche praxisnahe Präsentationenund Arbeitsforen laden <strong>zum</strong> Input und Austauschein. Darüber hinaus bietet das Programm zentrale Vorträge,eine mo<strong>der</strong>ierte Talkrunde mit Vertretern aus Wissenschaftund Praxis, Kulturbeiträge sowie eine ganztägigenFachausstellung.Vielfältige Adressaten willkommenMuseen, Musikschulen, Sportvereinen, Volkshochschulensowie an politische Entscheidungsträger in den Kommunenund allgemein Interessierte.Systematisch kooperieren mit <strong>der</strong> Initiative »BildungspartnerNRW«Mit <strong>der</strong> Initiative »Bildungspartner NRW« stärkt dieMedienberatung NRW seit 2005 systematische Kooperationenzwischen kommunalen Bildungseinrichtungen undSchulen. Am Anfang standen die Bibliotheken, bis heutehaben sich <strong>der</strong> Initiative Archive, Museen, Musikschulen,Medienzentren, Sportvereine und Volkshochschulen alsweitere Bildungspartner angeschlossen. Ziel <strong>der</strong> Bildungspartnerschaftenist die För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Bildungschancenaller Kin<strong>der</strong> und Jugendlichen in NRW – unabhängig vonihrer sozialen Herkunft und kulturellen Prägung.»Bildungspartner NRW« arbeitet im Auftrag des Ministeriumsfür Schule und Weiterbildung des Landes NRW.Informationen und Anmeldung unter:www.bildungspartner.schulministerium.nrw.deFolgen Sie unseren Kongressvorbereitungen auch aufTwitter: @bipa_nrwHashtag <strong>zum</strong> 5. Bildungspartnerkongress: #bipa13Der Kongress »Vielfalt. Nutzen.« richtet sich an Schulleiterinnenund Schulleiter, Lehrerinnen und Lehrer, Multiplikatoren<strong>der</strong> Lehrerfortbildung, Mitarbeiterinnen undMitarbeiter aus Kultur- und Schulverwaltungen <strong>der</strong> Städteund Gemeinden, Archiven, Bibliotheken, Medienzentren,Christin ArensChristin Arens ist Mitarbeiterin <strong>der</strong> Medienberatung NRW.50
MEDIENBRIEF | N° 02.201305 BesprechungenDVDs, Bücher und Apps ...Foto: Lupo/www.pixelio.de51
MEDIENBRIEF | N° 02.2013Lehrer und Lehrerinnen als»Akteure des Wandels«Will RichardsonWikis, Blogs und PodcastsNeue und nützliche Werkzeuge für denUnterricht236 Seiten, Tibiapress22,00 €ISBN 978-3935254175Alle fünf hier vorgestellten Bücher, so unterschiedlich sieauch sind und welche verschiedenen Facetten des Themassie auch in den Mittelpunkt stellen, haben ein gemeinsamesZiel: Die mo<strong>der</strong>nen digitalen Werkzeuge und Medienzu prüfen, um sie an konkreten Projekten sinnvoll,praktisch, alltagstauglich und nachhaltig einzusetzen – imUnterricht selbst als auch im schulischen Überbau.Vier <strong>der</strong> Bücher verstehen sich als »work in process«,eine Art »open Source«, d. h. die Autoren schreiben nichtnur über die digitalen Möglichkeiten, son<strong>der</strong>n nutzen sieselbst für ihr Buch und for<strong>der</strong>n die Leserschaft auf, sichaktiv zu beteiligen: zu reagieren, korrigieren o<strong>der</strong> weiterdaran zu arbeiten. Begleitende Homepages werden als»zusätzlicher Service« angeboten, vieles wird durch themenbezogene<strong>Link</strong>s vervollständigt.Hier ist das Buch in <strong>der</strong> digitalen Welt angekommen, nichtals beängstigende Konkurrenz, son<strong>der</strong>n als sinnvolle, gegenseitigeErgänzung und Weiterentwicklung.Wikis, Blogs und PodcastsNeue und nützliche Werkzeuge für den UnterrichtDieses Buch war in USA ein großer Erfolg und erscheintin Deutschland nun in einer überarbeiteten dritten Auflage.Das Buch geht von <strong>der</strong> These aus, dass durch das Netzund Kommunikationsformen wie Weblogs, Wikis, RSS undsoziale Netzwerke eine »Neue Literalität« entstanden ist,die ungeheurere neue Möglichkeiten für Schule und Lernenbietet. Die zentralen Verän<strong>der</strong>ungen werden an 10 konkretenBereichen dargestellt mit dem Ergebnis: »Das ist nur<strong>der</strong> Anfang«. Lehrer und Lehrerinnen werden als »Akteuredes Wandels« begriffen. Zahlreiche Icons verweisen auf(auch amerikanische) Web-Beispiele. Begleitet wird dasBuch durch aktuelle <strong>Link</strong>s und einer eigenen Web-Adresse.Obwohl schon etwas in die Jahre gekommen, ist dies einzukunftsorientiertes, mo<strong>der</strong>nes Buch mit direkter Unterrichtsanbindungund Web-Begleitung. Sehr empfehlenswert.52
05 | BESPRECHUNGENSina Müller / Yasmin SerthMit digitalen Medien den Schulalltagoptimieren66 praktische Ideen fürSelbstorganisation und Unterricht152 Seiten, Verlag an <strong>der</strong> Ruhr 2012 /16,90 €ISBN 978-38346096870968-7Doug Fodeman, Marje MonroePasswords, Phishing und private Daten– sicher leben im InternetEin Projektbuch205 Seiten, TibiaPress, Reihe: Web2.0für den Unterricht, 2011, 22,00 €ISBN 978-3-935254-18-2Mit digitalen Medien den Schulalltag optimieren66 praktische Ideen für Selbstorganisation und UnterrichtPasswords, Phishing und private Daten – sicher leben imInternet (Ein Projektbuch)Für alle Schulformen und Fächer werden zu vier Themenbereichen(Den schulischen Alltag organisieren, Rechtliches,Unterricht vorbereiten, durchführen und nachbearbeiten,Schüler werden aktiv) kurz und knapp tatsächlichinsgesamt 66 konkrete Ideen und Anregungen skizziert, mitzahlreichen Abbildungen, ausführlichem Glossar undbegleiten<strong>der</strong> Homepage, auf <strong>der</strong> die Ideen umgesetzt o<strong>der</strong>weiterentwickelt werden können. Jede Idee hat formal diegleiche Struktur (Medium/ Kurzbeschreibung/ Impulse/Vorbereitung und Ablauf) und reicht vom »Bloggen alsTagebuch« über »Stationenlernen in Notebook-Klassen«bis hin zu »Digital Storytelling« für Schüler,»Youtube« imUnterricht bis Themen wie: »Lern-Apps selbst erstellen«.Ein mo<strong>der</strong>nes, alltagsnahes und praktisches Buch mitmotivierenden <strong>aktuellen</strong> Beispielen für Unterricht undSelbstmanagement. Unbedingte Empfehlung.Das Buch versteht sich als »Arbeitsbuch <strong>zum</strong> ThemaInternetsicherheit« mit 100 Übungen für die Gruppenarbeit,ausdrücklich nicht nur für Schule, son<strong>der</strong>n auch fürJugendliche und Erwachsene im außerschulischen Bereich.Die Übungen sind reich bebil<strong>der</strong>t, übersichtlich dargestellt,und motivieren zur Nutzung. Es geht um Privatsphäre undIdentitätsdiebstahl ebenso wie um Cyber-Mobbing,Phishing, Scans und konkrete Regeln für die Internetsicherheitzu Hause. Unzählige <strong>Link</strong>s und eine eigene MailAdresse for<strong>der</strong>n auf, das Buch interaktiv zu nutzen.Das Projekthandbuch hält, was <strong>der</strong> Titel verspricht. DieÜbungen können sofort umgesetzt werden. Die Kopplungmit dem Netz öffnet das Buch für die Zukunft.Lese- und Nutzungsempfehlung.53
MEDIENBRIEF | N° 02.2013Martin KohnSchulentwicklung 2.0Digitale Lern- und Arbeitswelten157 Seiten, Belz Medienpädagogik, 2011,22.90 €ISBN 978-3-407-25551-8Phillipe WampflerFacebook, Blogs und Wikis in <strong>der</strong>SchuleEin Social-Media-Leitfaden174 Seiten, Vandenhoeck & Ruprecht,2013, 24,90 €ISBN 978-3-525-70165-2Auch als e-book erhältlich:ISBN 987-3-647-70165-3Schulentwicklung 2.0Digitale Lern- und ArbeitsweltenFacebook, Blogs und Wikis in <strong>der</strong> SchuleEin Social-Media-LeitfadenDas Buch zeigt an zahlreichen praktischen Beispielen auf,wie das »2.0« den gesamten Schulalltag erfasst hat:Verwaltung 2.0 (Intranet, digitales Klassenbuch), Organisation2.0 (Peer Coaching, Projektatlas), Unterricht 2.0(Computerzertifikat, digitale Schultasche), Hausaufgaben2.0 (Digitale Lernplattformen), Web 2.0 (Netbook-Klassen)und Recht 2.0.Am Ende wird dieser ausführliche Rundumschlag des in <strong>der</strong>renommierten, von Nobert Neuß herausgegebenen Reihe»Beltz Medienpädagogik« doch etwas vorsichtig, wenn nichtsogar konservativ. Im »Ausblick« heißt es: »Die Schule 2.0<strong>der</strong> Wissens- und Informationsgesellschaft wird sich denneuen Herausfor<strong>der</strong>ungen, aber auch Chancen undMöglichkeiten, die die neuen Medien bieten, nicht verschließen«.Hier könnte auch stehen: Schule und Lehrkörper sindbereits seit Langem Teil des Prozesses und gestalten ihnauch in Zukunft aktiv und innovativ mit.Ausführliches Standardwerk von 2011, wird von <strong>der</strong>digitalen Beschleunigung ein wenig eingeholt. KeineVerbindungen <strong>zum</strong> Netz. Bedingte Leseempfehlung.Das Buch ist aus einem Blog entstanden und hat somitzahlreiche Autoren, wie <strong>der</strong> Gymnasiallehrer bemerkt. Erlädt ein, auch an dem Buch mit und weiter zu arbeiten:»Dieses Buch ist nicht fertig«. Adresse, Internet unde-mail-Adresse laden zur Interaktion ein. Das Buch istselbst wie ein Blog aufgebaut und konzertiert sich in <strong>der</strong>Herangehensweise auf social media im Kontext Schule insehr aktueller und alltagsnaher Form. Begriffe und Themenwie »Learning by lurking«,»Infotention«, »Javascript alsneues Latein« o<strong>der</strong> »Algorithmen als die Akteure <strong>der</strong>Zukunft« weisen auf eine rasante Entwicklung hin, auf dieSchule reagieren muss. Im Materialteil hat <strong>der</strong> Autorzahlreiche Merkblätter und konkrete Unterrichtseinheitenzusammengestellt.Kein übersichtlich strukturierter Leitfaden, eher wie einBlog <strong>zum</strong> Mitmachen, interessant für diejenigen, die dasspezielle Thema zur Interaktion anregt und zukunftsorientiertdenkt. Bedingte Empfehlung.Dr. Michael Troesser54
05 | BESPRECHUNGENWer war Kafka?Filmporträt liefert erhellende Einblicke in diegeheimnisvolle Welt des Franz KafkaSeine Werke gehören unbestritten <strong>zum</strong> deutschsprachigen Kanon <strong>der</strong> Weltliteratur. Doch welcher Mensch verbirgt sichhinter dem Namen Franz Kafka? Welche Gedanken und Gefühle bewegten den Autor weltberühmter Erzählungen wie<strong>der</strong> »Verwandlung«?Antworten auf diese Fragen liefert»Wer war Kafka?« – ein Porträt vonRichard Dindo, das 2006 im Auftragvon Arte entstand. In fünf Kapitelnbegibt sich <strong>der</strong> Film auf Spurensuchein Prag – <strong>der</strong> Stadt, in <strong>der</strong> FranzKafka 1883 als Sohn einer deutschsprachigen,bürgerlich-jüdischenKaufmannsfamilie seine Kindheit verbrachteund nach Jura-Studium undPromotion sein Geld als Beamter ineiner Versicherungsanstalt verdiente.Die tiefe Verbundenheit Kafkas mitseiner Heimatstadt, die er in langenSpaziergängen erkundete undmit <strong>der</strong>en jüdischer Tradition er sicheingehend auseinan<strong>der</strong>setzte, wirddurch historische Bil<strong>der</strong> sowie aktuelleFilmaufnahmen veranschaulicht:Zu sehen sind Kafkas Elternhaus amAltstädter Ring, die Karlsbrücke, dieAltstadt, das Judenviertel Josefstadtund vieles mehr. Vor diesem visuellenHintergrund kommen Weggefährten,Freunde und Bewun<strong>der</strong>er Kafkas zuWort: Max Brod, Gustav Janouch, MaxPulver, Felice Bauer, Milena Jesens-WER WAR KAFKA?Dokumentation, Regie: Richard Dindo, 2006, Farbe u.s/w, 97 MinutenDarsteller/Sprecher: Ulrich Matthes, EkkhardAlexan<strong>der</strong> Wachholz, Hana Militká u.a.DVD mit schulischem Vorführrecht erhältlich bei:Lingua-Video.com, Ubierstraße 94, 53173 Bonn,Tel. 0228 / 85 46 95 - 0info@lingua-video.com / www.lingua-video.com55
MEDIENBRIEF | N° 02.2013Die dir zugemessene Zeit ist so kurz, dass du, wenn du eine Sekunde verlierst,schon dein ganzes Leben verloren hast, denn es ist nicht länger; es ist immernur so lang wie die Zeit, die du verlierst. (Franz Kafka)ká und Dora Diamant werden vonSchauspielern verkörpert und auspersönlichen Aufzeichnungen zitiert.Aus erster Hand schil<strong>der</strong>n sie Erinnerungenund Begegnungen. Begeistertberichtet Kafkas engster Freund undspäterer Nachlassverwalter Max Brodvon gemeinsamen Ausflügen an dieMoldau und angeregten Gesprächenüber Kafkas Werke.Zwischen diesen ausführlichen O-Tönenund den fast meditativen Filmsequenzenist vor allem immer wie<strong>der</strong>Kafka selbst zu hören – dank <strong>der</strong> unverwechselbarenbesetzten Stimmevon Ulrich Matthes, <strong>der</strong> aus KafkasTagebüchern und Briefen zitiert. Aufdiese Weise gelingt die Erkundung<strong>der</strong> »kafkaesken« Gedankenwelt und<strong>der</strong> zutiefst zerrissenen Seele einesMenschen, <strong>der</strong> am Leben verzweifelteund dessen einzige Rettung die Literaturwar: »Kafka musste schreiben,weil das Schreiben seine Lebensluftwar.«Denn Kafka leidet. Er leidet unterinnerer Einsamkeit und dem schwierigenVerhältnis <strong>zum</strong> Vater, den er alsTyrann erlebt und dem er in Hassliebeverbunden ist. Die Arbeit in <strong>der</strong>Versicherung empfindet er als Qualund reinen »Brotberuf«. Seine Beziehungenzu Frauen sind durch stetigeSelbstzweifel belastet. Die fortschreitendeTuberkulose-Erkrankung tut ihrÜbriges. Die Nächte verbringt Kafkaschlaflos und mit Schreiben: »Wo ist<strong>der</strong> ewige Frühling? Die Zeit vergehtund man vergeht nutzlos mit ihr. Alles,was nicht Literatur ist, langweilt mich(…) stört mich, hält mich auf.«Der Kampf mit den eigenen Gefühlen,die fortwährende Selbstreflexion unddie Liebe <strong>zum</strong> Schreiben – mit all demzieht Kafka gerade junge Menschen inden Bann und begeistert sie für Literatur.Kafkas enorme Bedeutung fürdie Nachwelt formuliert am Schlussdes Films die Journalistin und SchriftstellerinMilena Jesenská, <strong>der</strong> sichKafka in vielen Briefen anvertraute:»Er schrieb die bedeutendsten Bücher<strong>der</strong> jungen deutschen Literatur. DasRingen <strong>der</strong> heutigen Generation <strong>der</strong>ganzen Welt ist in ihnen.«Wer war Kafka? Diese Frage istsicherlich nicht abschließend zubeantworten. Doch eröffnet <strong>der</strong> Filmheutigen Schülerinnen und Schülernerhellende Einblicke in den rätselhaftenKafka-Kosmos und führt so zueinem besseren Verständnis <strong>der</strong> Werke.Dies gilt auch für »Die Verwandlung«,Kafkas berühmte und verfilmteErzählung, die ab 2015 Abiturthema inNRW ist.Dr. Martin KöttDr. Martin Kött ist wissenschaftlicherMitarbeiter bei Lingua-Video.com.56
MEDIENBRIEF | N° 02.201306 LVR-ZMBinternAus dem Medienbestand ... MitarbeiterinporträtFoto: Rainer Sturm/www.pixelio.de58
06 | LVR-ZMBAudiovisuelle Medien zugellschaftsrelevanten Themen(Auswahl)Sexuell übertragbare Krankheiten inkl. HIV/AIDSNicht nur HIV, auch an<strong>der</strong>e sexuell übertragbare Krankheiten können schwerwiegendeFolgen haben, wie z. B. Unfruchtbarkeit nach unbehandelter Chlamydieninfektion.Die didaktische Film-DVD enthält 60 Minuten Film und interaktiveAngebote (Wissenstests, Lexikon) für die Arbeit mit 14- bis 18-jährigen Jugendlichen.Die Inhalte des Filmteils sind in verhaltensbezogener Problemstellung(30-min-Jugendspielfilm) und als Grundlagenwissen (altersgerechte Biologie-Animationsfilme, 5x5 min) aufbereitet, um beim Thema Gesundheit einenganzheitlichen Zugang und fächerübergreifendes Arbeiten zu för<strong>der</strong>n, z. B.zwischen Sozialkunde/Ethik und Biologie. – Das Begleitheft kann aufwww.bzga-avmedien.de downgeloaded werden. (Signatur: 46 42847)Chat-GeflüsterIss Zucker und sprichAmok in KölnAbseits?!Saufen bis <strong>der</strong> ArztLeben mit MS ...Signatur: 46 43332süßSignatur: 46 42184Signatur: 46 42801kommtSignatur: 46 43051Signatur: 46 41468Signatur: 46 42870Das Prinzip Alkohol:Wenn das Wort imAmokDer IndianerPflege mit VerständnisBehin<strong>der</strong>te LiebeMein Kind imMund zerbrichtSignatur: 46 44134Signatur: 46 40947Signatur: 46 44529(I, II & III)VollrauschSignatur: 46 44114Signatur: 46 42611 (1)Signatur: 46 4361046 43033 (2), 46 43034 (3)59
MEDIENBRIEF | N° 02.2013Ein Leben mit <strong>der</strong>Außen vorBabysDer Ball/The BallCybermobbinggDas bin ichAngstSignatur: 46 44111Signatur: 46 44092Signatur: 46 44368Signatur: 46 43299Signatur: 46 43685Signatur: 46 43052Boy AEhreEines TagesEinfache FahrtFelixMethoden <strong>der</strong>Signatur: 46 43518Signatur: 46 43036Signatur: 46 43274Signatur: 46 44338Signatur: 46 42843EmpfängnisverhütungSignatur: 46 02827Ich bin mir GruppeIndividualisierungKaum mehr als nichtsKaum mehr als nichtsWeggegangen,Warum werden unseregenugSignatur: 46 43968(I)(II)angekommen,Kin<strong>der</strong> immer dicker?Signatur: 46 43035Signatur: 46 44115Signatur: 46 44116geblieben ... und dann?Signatur: 46 42295Signatur: 46 4252560
06 | LVR-ZMBAuszug von Spielfilmen mitLandeslizenzen bei EDMOND NRWDer Ball/The BallD 2011, 11 min f , Signatur: 55 59784Zwischen Reihenhäusern und Garagentoren in einem heruntergekommenenArbeiterviertel spielt Amy alleine Fußball. Jack, neu zugezogen, beobachtet siedabei von seinem Fenster aus. Die beiden nehmen auf sehr einfallsreiche WeiseKontakt zueinan<strong>der</strong> auf. Allerdings vermeidet Jack eine unmittelbare Begegnung.Als Amy in eine Handgreiflichkeit mit einer Mädchenclique gerät, greift Jackplötzlich ein und vertreibt die Mädchen. Amy bedankt sich für seine Hilfe, Jackaber läuft zu seinem Haus und schließt die Gartenpforte hinter sich. WenigeAugenblicke später kommt er zurück. Schweigend stehen sie sich gegenüber. InGebärdensprache nennt Jack seinen Namen, aber Amy versteht ihn nicht. Als erresigniert weggeht, rollt sie ihren Ball vor seine Füße.Renn, wenn du kannstD 2010, 112 min f, Signatur:5532688Ben, ein junger, querschnittsgelähmter Mann, beschimpft jeden, <strong>der</strong> sich um ihnkümmert – auch Christian, seinen Zivildienstleistenden. Der geht erstaunlichgelassen mit den Anfeindungen um. Schließlich werden die beiden doch nochFreunde. Eines Tages begegnet ihnen die eigensinnige Cellostudentin Annika.Beide verlieben sich in sie. Annika ist hin- und hergerissen: Zunächst fühlt siesich zu dem fröhlichen, leichtfüßigen Christian hingezogen. Ben glaubt, keineChance bei ihr zu haben. Er geht davon aus, als körperlich behin<strong>der</strong>ter Menschnicht attraktiv für sie zu sein. Doch es kommt an<strong>der</strong>s. Zwischen Annika und ihmentwickelt sich eine Beziehung, die sie an ihre emotionalen Grenzen stoßen lässt.Die WelleD 2008, 107 min f, Signatur: 55 60290Von Anfang an machen die Oberstufenschüler in <strong>der</strong> Projektwoche <strong>zum</strong> ThemaAutokratie deutlich, dass sie keine Lust haben, schon wie<strong>der</strong> über den Nationalsozialismuszu sprechen. Ihr Lehrer stellt darauf hin seinen Unterrichtsstil um.So führt er strenge Verhaltensregeln ein. Doch zu seiner Überraschung stößtdies nicht auf Ablehnung. Die meisten Schüler machen bereitwillig mit. Auf dieRegeln folgen an den nächsten Tagen eine Uniform, <strong>der</strong> Gruppenname »DieWelle« und ein Erkennungszeichen. Doch zugleich nutzen die Schüler ihr neuesZusammengehörigkeitsgefühl auch, um an<strong>der</strong>e unter Druck zu setzen. Und auchWenger droht seine Rolle als charismatisches Idol zu entgleiten ...61
MEDIENBRIEF | N° 02.2013An ihr kommt je<strong>der</strong> vorbeiNordlicht als rheinische Frohnatur am Empfang des LVR-ZMBAls Andrea Glathe vor 13 Jahren <strong>der</strong>Liebe wegen aus Lübeck nach NRWkam, erlebte die gelernte Köchin undFachfrau für Bürokommunikationzwei »Kulturschocks«. Zum einen dieellenlangen Verkehrsnachrichten imRadio, die im Gegensatz <strong>zum</strong> Norden»gefühlt nie aufhören«, und <strong>der</strong>Karneval in Köln. »Alle verkleidet, inje<strong>der</strong> Seitenstraße, überall, wie imFernsehen, unglaublich« und siebekam »das Lächeln nicht mehr ausdem Gesicht«. Aus dem Lächeln istdann aber schnell ein breites Lachengeworden, sie ließ sich anstecken von<strong>der</strong> Fröhlichkeit, diesem ausgelassenenTreiben, denn das passte <strong>der</strong> nordischenFrohnatur sehr.Ernst wurde es erst wie<strong>der</strong>, als eineFreundin ihr eine Stellenausschreibungdes LVR-Zentrums für Medienund Bildung in Düsseldorf zeigte. Daskönnte passen, dachte Andrea Glathesich, allerdings diese drei BuchstabenL,V und R mussten erst noch interpretiertwerden, auch das »LVR-Zentrumfür Medien und Bildung«, auf dessenInternetseiten sie sich erst einmalzurechtfinden musste, schien ihr nichtganz unkompliziert.Seit Frühjahr 2013 hat sie ihrenArbeitsplatz an <strong>der</strong> »Pforte« im viertenStock, begrüßt alle Besucherinnen undBesucher und an ihr kommt imwahrsten Sinne des Wortes seitdemje<strong>der</strong> vorbei.Fährt sie abends heim nach Dormagen,freut sie sich nicht nur auf ihrenFoto: privatPartner und dessen Tochter, son<strong>der</strong>nauch auf den Rhein. Sie liebt diesenFluss, <strong>der</strong> immer in Bewegung ist, sowie sie selbst. Allerdings kann <strong>der</strong>Rhein ihr nicht ganz das Meerersetzen: »Bei schönem Sommerwettersehne ich mich nach <strong>der</strong> Ostsee.Der Himmel ist so wahnsinnig blau imNorden, das Wasser und <strong>der</strong> Horizonthaben mich verwöhnt.« Von Lübeckaus, wo ihre Eltern eine Gastwirtschaftbetreiben, fuhr sie oft nachtsnach dem Feiern schnell nachTravemünde, um zusammen mit ihrenFreunden in <strong>der</strong> Ostsee ein erfrischendesBad zu nehmen.Zurück im Rheinland entschädigt siedie Lebensfreude <strong>der</strong> Menschen hier.In Köln ist viel los und Andrea istimmer dabei. »Anscheinend passe ichhierher« sagt sie und ergänzt:»Rheinlän<strong>der</strong> und Nordlichter, diescheinen sich gut zu ergänzen«.Absoluter Höhepunkt <strong>der</strong> lebensbejahendenMenschenfreundin ist – nebenComputerspielen o<strong>der</strong> Konzerten von»Rammstein« und »Mando Diao« –einmal im Jahr eine Woche in Brokelohbei Hannover zu verbringen. Hierkann sie mit schweren Baumwollblusenund Röcken verkleidet in dasLife-Rollenspiel abtauchen, ist Teileiner ganz an<strong>der</strong>en Welt, lebt mitihrem Freund und weiteren 6000Gleichgesinnten in Zelten auf einemgroßen Acker. Hier wird gespielt undgekämpft, bis die Realität sie wie<strong>der</strong>zurück ins Leben holt.Dr. Michael TroesserDr. Michael Troesser ist stellvertreten<strong>der</strong>Leiter des LVR-Zentrums fürMedien und Bildung und Leiter <strong>der</strong>Abteilung Medienbildung.62
07 LernortKultur1914 – Welt in Farbe ... Man Ray ... Bernd und Hilla BecherAlbert Kahn, Les archives de la planète, Stéphane Passet, Marokko, Fès, Porträt eines senegalesischen Scharfschützen,© Musée Albert-Kahn, Frankreich63
MEDIENBRIEF | N° 02.2013»Welt in Farbe«Farbfotografie vor dem KriegAlbert Kahn, Les archives de la planète, Stéphane Passet, Mongolei, nahe Ulaanbaatar, wahrscheinlich Damdinbazar,die achte Inkarnation des mongolischen Jalkhanz Kuthugtu, © Musée Albert-Kahn, FrankreichIn »1914 - Welt in Farbe« tritt uns einelängst versunkene, verwunscheneWelt entgegen. Mit dieser Ausstellungvom 24. September 2013 bis <strong>zum</strong> 23.März 2014 widmet sich das LVR-LandesMuseumBonn einem wenigerbeachteten Kapitel <strong>der</strong> FotografieundMediengeschichte am Vorabenddes Ersten Weltkriegs.Im Mittelpunkt stehen Farbfotografien<strong>der</strong> »Archives de la planète«, begründetvom aus dem Elsass stammendenjüdischen Bankier Albert Kahn(1860–1940). Hingerissen von einem1903 patentierten farbfotografischenVerfahren <strong>der</strong> Gebrü<strong>der</strong> Lumière,beauftragte er im Jahr 1908 Fotografenund Kamerateams, die Welt inFarbe festzuhalten. Im Verlauf vonzwei Jahrzehnten trugen sie rund72.000 farbige Diapositive und 180.000m (etwa 100 Stunden) Film zusammen.Dichte Filter und unempfindlichesFilmmaterial for<strong>der</strong>ten direktesSonnenlicht und starre Posen, dieneben den schillernden Farben <strong>zum</strong>Markenzeichen <strong>der</strong> Fotografienwurden.Der radikale Unterschied zur früherenReisefotografie liegt jedoch in Kahns64
07 | LERNORT KULTURpersönlichem wie globalen Anliegen:Verständnis für an<strong>der</strong>e Menschen und<strong>der</strong>en Kultur und damit eine friedlicheWelt schaffen.Ein weiterer Protagonist ist AdolfMiethe, Erfin<strong>der</strong> einer panchromatischenFilmbeschichtung und damitUrheber des Dreifarbendrucks. SeineVorführung im Kaiserhaus brachteihm den Auftrag zur farbigen Dokumentationdeutscher Landschaften fürdie Weltausstellung in St. Louis 1904.Als Sammelbil<strong>der</strong> in Schokoladentafelnerfreuten sie sich großer Beliebtheit.So entstand <strong>der</strong> erste fotografischeFarbbildband Deutschlands, dasStollwerk-Album. Ein Original kann in<strong>der</strong> Ausstellung durchgeblättertwerden.Das Genre <strong>der</strong> Bildpostkarten, oft alsChromolithografie nachträglich inFarbe gesetzt und ab 1890 im europäischenPostverkehr zugelassen, rundetdie Ausstellung ab.Zur Ausstellung erscheint ein Katalogmit über 100 großformatigen Abbildungen,<strong>der</strong> im Museumsshop <strong>zum</strong>Vorzugspreis erhältlich ist.Die Ausstellung bildet den Auftakt<strong>zum</strong> Themenjahr »1914 – Mitten inEuropa. Das Rheinland und <strong>der</strong> ErsteWeltkrieg« des LVR-Dezernats fürKultur und Umwelt sowie zahlreicherMuseen und Kultureinrichtungen imgesamten Rheinland (www.rheinland1914.lvr.de).Wiebke SieverWeitere Informationen:www.landesmuseum-bonn.lvr.deLVR-LandesMuseum Bonn,Colmantstr. 14-16, 53115 BonnÖffnungszeiten: Di.-Fr. und So. 11 - 18 Uhr, Sa. 13 -18 Uhr, Mo. geschlossenWiebke Sievers ist WissenschaftlicheVolontärin im LVR-LandesMuseumBonn.Albert Kahn, Les archives de la planète, Stéphane Passet, Indien, Ahmadabad, Zwei Gläubige im HathiSingh-Tempel, © Musée Albert-Kahn, FrankreichDas Miethe’sche Verfahren inspirierteauch den russischen FotografenSergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii,<strong>der</strong> zwischen 1909 und 1915 imAuftrag des Zaren Nikolaus II.Russland in mehreren TausendFotografien von großer Brillanzdokumentierte. Drei Belichtungenhintereinan<strong>der</strong> führen auch hier zustarren Posen. Dieser einzigartigeBil<strong>der</strong>schatz blieb infolge hoherReproduktionskosten und letztlich <strong>der</strong>Revolutionsfolgen einer breitenÖffentlichkeit verborgen.Noch vor Kahn, Miethe und an<strong>der</strong>eninteressierte sich <strong>der</strong> BerlinerBildverleger August Fuhrmann fürFarbbil<strong>der</strong>. Seine Kaiserpanoramen,benannt nach dem ersten Standortdes Unternehmens in <strong>der</strong> Kaiserpassagean <strong>der</strong> Berliner Friedrichstraße,waren handkolorierte Stereo-Bildserienund sollten den MenschenKenntnisse <strong>der</strong> ganzen Welt vermitteln.Originale Kaiserpanoramenwerden in <strong>der</strong> Ausstellung vorgeführt.65
MEDIENBRIEF | N° 02.2013Man Ray -Fotograf im Paris <strong>der</strong> SurrealistenAusstellung im Max Ernst Museum Brühl des LVR vom 15.09. bis 08.12.2013»Ich bin kein Fotograf <strong>der</strong> Natur, blanche« von 1926. Sie sind Wegmarken<strong>der</strong> Befreiung <strong>der</strong> Fotografie ausson<strong>der</strong>n meiner Phantasie.«(Man Ray)ihrer dokumentierenden Abbildhaftigkeit.Man Ray (1890-1976) hat unsereVorstellung von dem, was Fotografie Das Max Ernst Museum Brühl des LVRist, entscheidend geprägt. Die experimentellenund suggestiven Gestaltun-Fotograf im Paris <strong>der</strong> Surrealisten«zeigt in <strong>der</strong> Ausstellung »Man Ray -gen des »großen Poeten <strong>der</strong> Dunkelkammer«(Jean Cocteau) machen ihn lungen führen<strong>der</strong> Museen in Deutsch-rund 150 Fotografien aus den Samm-zu einem <strong>der</strong> wichtigsten Fotokünstler land, Frankreich und den USA sowiedes 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts. Die 1920er und aus zahlreichen Privatsammlungen.1930er Jahre gelten als die produktivstenseines Schaffens. Im Paris des Suche nach Ausdrucksmöglichkeiten,Die Auswahl folgt dabei Man RaysDadaismus und Surrealismus entstehenim Kreise von Max Ernst, Marcel tastische zu erweitern.um die Fotografie in das Surreal-Fan-Duchamp o<strong>der</strong> Salvador Dalí bedeutendeArbeiten wie »Le ViolonAnfang <strong>der</strong> 1920er Jahre entwickeltd’Ingres« von 1924 o<strong>der</strong> »Noire et Man Ray die sogenannten Rayografien,Man Ray, Larmes, 1930-1932, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles,© Man Ray Trust, Paris / VG Bild-Kunst, Bonn 2013.bei denen Gegenstände auf Fotopapiergelegt und belichtet werden. Mitdieser kameralosen Fotografie bannt<strong>der</strong> »Chemiker <strong>der</strong> Geheimnisse«(Georges Ribemont-Dessaignes) neueSichtweisen auf unsere Wirklichkeitund erfindet faszinierende Bildweltenaus Licht und Schatten.Zur selben Zeit entstehen Porträts vonKünstlern und Literaten <strong>der</strong> PariserSzene sowie Aktdarstellungen, dieMan Rays magische Lichtregie de–monstrieren. Er nutzt insbeson<strong>der</strong>edie Solarisation, die durch starkeÜberbelichtung im Entwicklungsprozessentsteht, als surrealistischenVerfremdungseffekt: Körper undGegenstände erstrahlen wie in einegeheimnisvolle Aura getaucht. Sokann sich <strong>der</strong> »Lichtmaler« alsFotograf unter den Surrealistenbehaupten und als bedeuten<strong>der</strong>Fotokünstler etablieren.Dr. Achim Sommer/Patrick BlümelPreis des Katalogs – 288 Seiten, ca. 200 Abbildungen -an <strong>der</strong> Museumkasse: 29,90 €Max Ernst Museum Brühl des LVRComesstraße 42 / Max-Ernst-Allee 150321 Brühl (Rheinland)Öffnungszeiten:Dienstag - Sonntag: 11 - 18 Uhrsowie 3. Oktober (Tag <strong>der</strong> Deutschen Einheit) und 1.November (Allerheiligen)Dr. Achim Sommer ist Direktor desMax Ernst Museums Brühl des LVRund Kurator <strong>der</strong> Ausstellung mitPatrick Blümel, dem WissenschaftlichenVolontären.66
07 | LERNORT KULTURBernd und Hilla Becher:HochofenwerkeEine Ausstellung vom 20. September 2013 bis 26. Januar 2014Hochöfen beherrschten einmal – nichtnur im Ruhrgebiet – das Bild zahlreicherRegionen in Deutschland.Mittlerweile haben sie, um ein Bildaus dem Naturschutz zu verwenden,eher den Status einer »gefährdeten«Art. Mit dem Nie<strong>der</strong>gang <strong>der</strong> Schwerindustrieverschwindet auch immermehr ein Stück Industriearchitektur.Das Fotografen-Ehepaar Bernd undHilla Becher hat seit den 1960erJahren mit <strong>der</strong> »Akribie von Naturforschern«die »Arten-Vielfalt« vonHochöfen und an<strong>der</strong>en industriellenGroßanlagen festgehalten: strengdokumentarisch, sachlich, und doch– poetisch schön...Die Photographische Sammlung <strong>der</strong>SK Stiftung Kultur breitet in ihrerAusstellung vom 20.09.2013 bis <strong>zum</strong>26.01.2014 diese Werkgruppe in eineropulenten Bil<strong>der</strong>schau von über 300teils großformatigen SchwarzweißaufnahmenausGabriele Conrath-SchollDie Photographische Sammlung/SK StiftungKultur, Im Mediapark 7,50670 Köln, Tel.: 0221/88895300,photographie@sk-kultur.de,www.photographie-sk-kultur.deDie Ausstellung ist täglich außer mittwochs, 14 -19Uhr, geöffnet, Eintritt: 4,50 € (ermäßigt 2 €),Mo. freier EintrittLübeck-Herrenwyk, D 1983, © Hilla Becher, 2013Gabriele Conrath-Scholl ist Leiterin<strong>der</strong> Photographischen Sammlung/SK Stiftung Kultur.67
Foto: Dominik Schmitz, LVR-ZMBLVR-Zentrum für Medien und BildungMedienzentrum für die Landeshauptstadt DüsseldorfBertha-von-Suttner-Platz 1, 40227 Düsseldorfwww.medien-und-bildung.lvr.deISSN 1615-7257